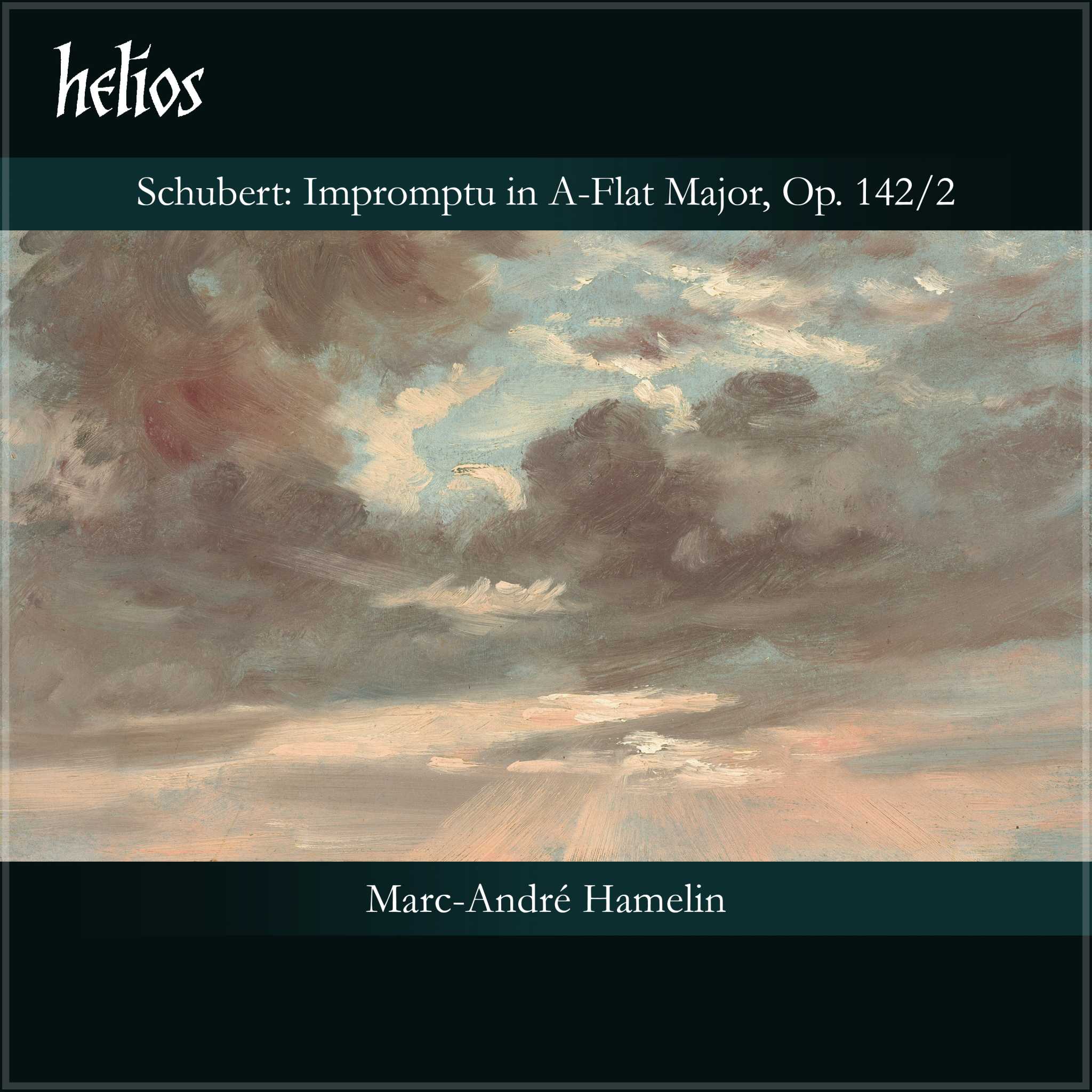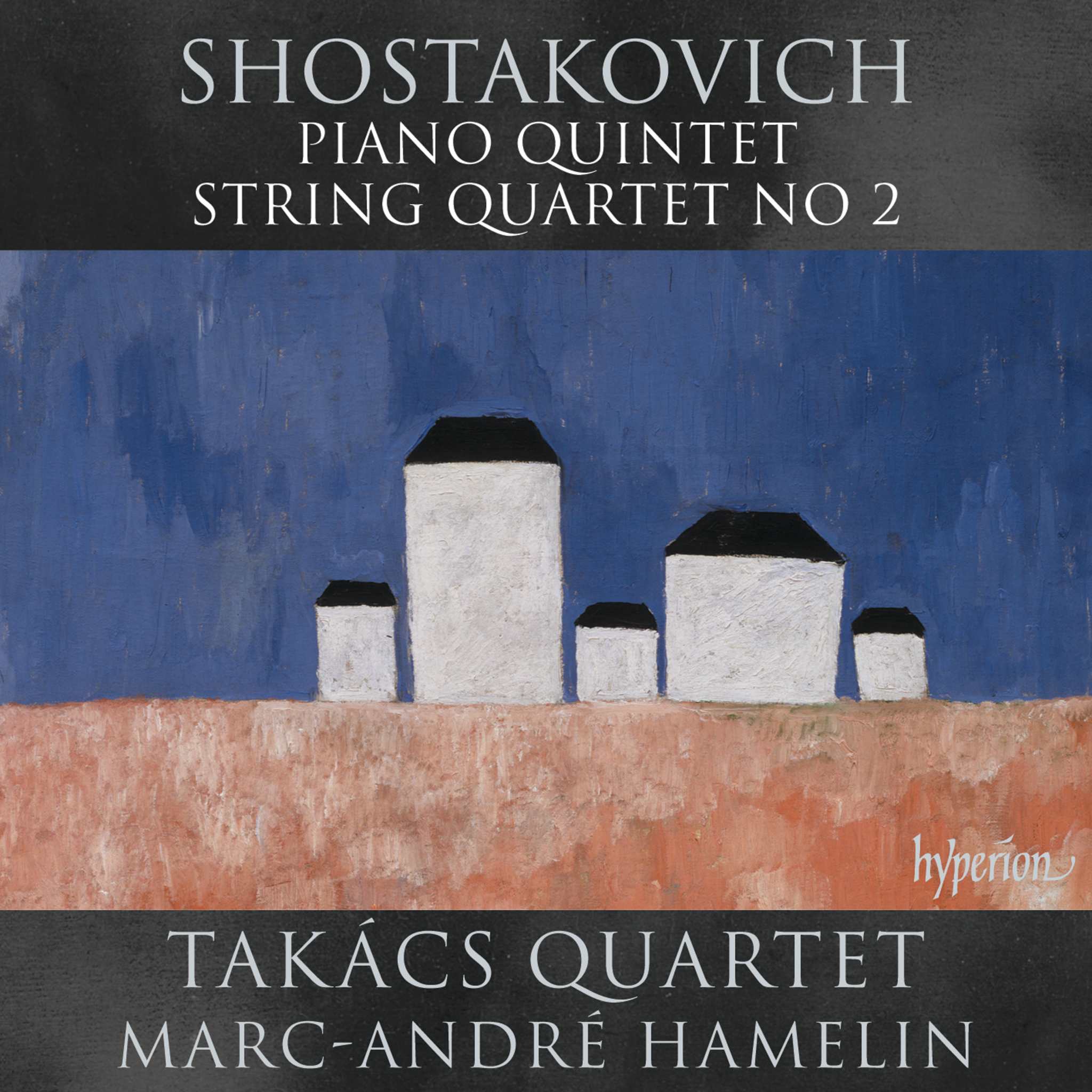Londoner Broadwood-Instrumenten In der öffentlichen Wahrnehmung wird Joseph Haydn häufiger mit Symphonien und Streichquartetten assoziiert als mit Klaviersonaten. Obwohl er am Klavier durchaus versiert war, bezeichnete er sich selbst nicht als Virtuosen. Haydn startete seine Arbeitstage regelmäßig am Klavichord, Cembalo oder Fortepiano, um musikalische Einfälle zu entwickeln, ehe er Tastenwerke komponierte. Seine Klavierkompositionen reichen von frühen Cembalostücken bis zu den von Londoner Broadwood-Instrumenten beeinflussten Sonaten Nr. 50 bis 52.
Mit über sechzig Sonaten dokumentiert Haydns Klavierwerk die Entwicklung der klassischen Sonatenform besonders eindrücklich und umfassender als das von Mozart. Ein Beispiel ist die Sonate Nr. 46 in As-Dur, die nach Haydns Ernennung zum Kapellmeister entstand und eine gesteigerte musikalische Ausdruckskraft erkennen lässt. Das Adagio überrascht mit einem Wechsel nach Des-Dur und vermittelt große Nähe, während das Finale die Spannung auflöst und dennoch zielgerichtet bleibt.
Die Sonate Nr. 43 besticht durch galanten Stil, ist jedoch weniger substanziell. Die Sonaten Nr. 23 und 24 zeigen mehr Originalität und dramatische Akzente. Besonders die Sonaten Nr. 32 und 37 illustrieren Haydns Wandel von galantem Ton zu entschlossener Ernsthaftigkeit. Die 1773 entstandene Sammlung von sechs Sonaten demonstriert eine größere dramatische Vielfalt als Sonate Nr. 43.
Die Sonaten Nr. 40 bis 42 zeichnen sich durch Komplexität und feine Details aus und verlangen eine nuancierte Interpretation. Die C-Dur-Sonate Nr. 50 gilt als Haydns brillanter Beitrag mit konzentrierter thematischer Arbeit. Die Es-Dur-Sonate Nr. 52 wird als Haydns großzügigste und edelste Klaviersonate angesehen, geprägt von kühner Harmonik und überraschenden Wendungen.
Diese Werke, ursprünglich für Aufführungen im privaten Rahmen geschaffen, unterscheiden sich deutlich von den großformatigen Sonaten, die Haydn später für professionelle Pianistinnen wie Therese Jansen schrieb. Die heitere und kunstvoll gestaltete Musik gipfelt im funkelnden Scherzo der Nr. 50 und in der beinahe symphonischen Es-Dur-Sonate Nr. 52, die als Höhepunkt von Haydns Klavierschaffen gilt.