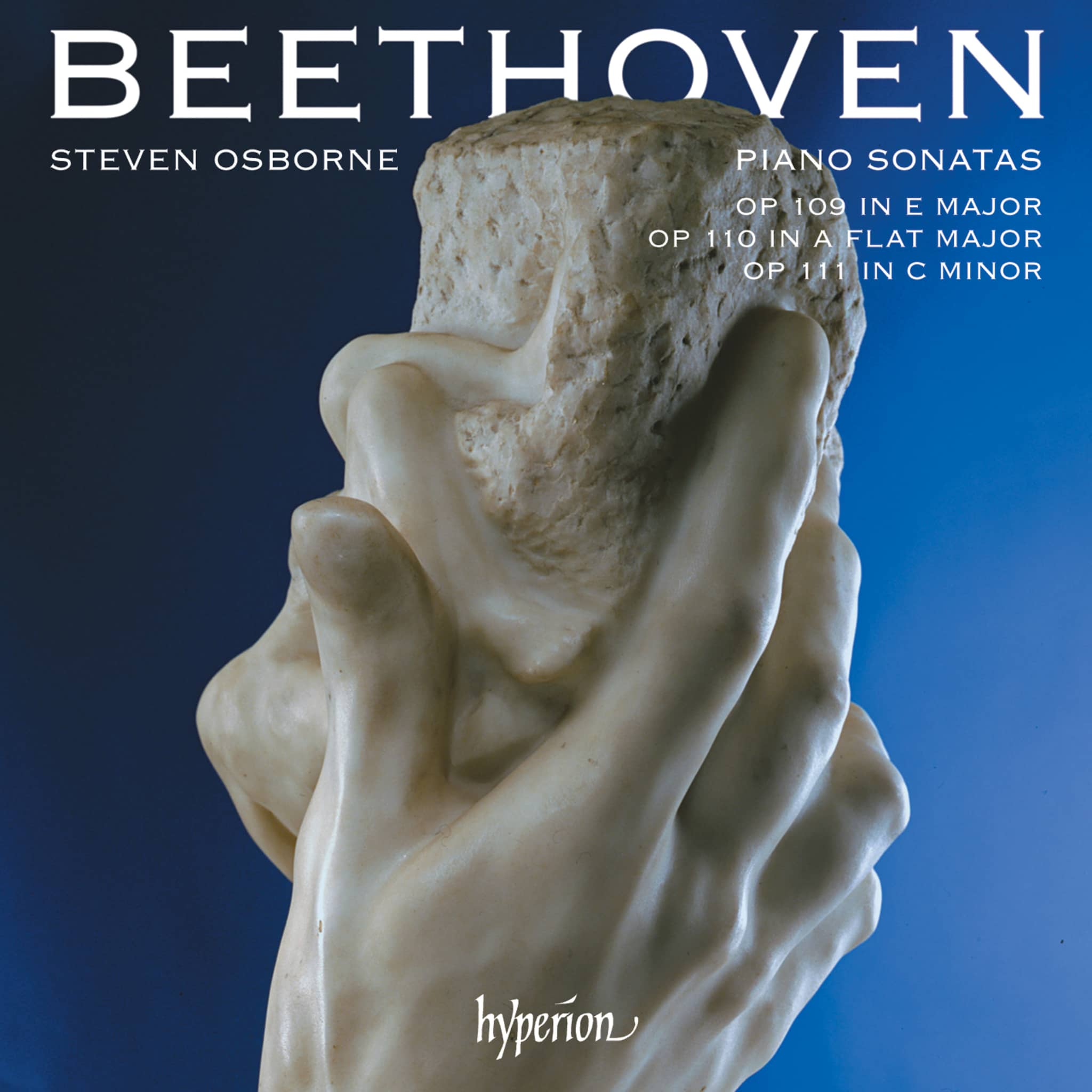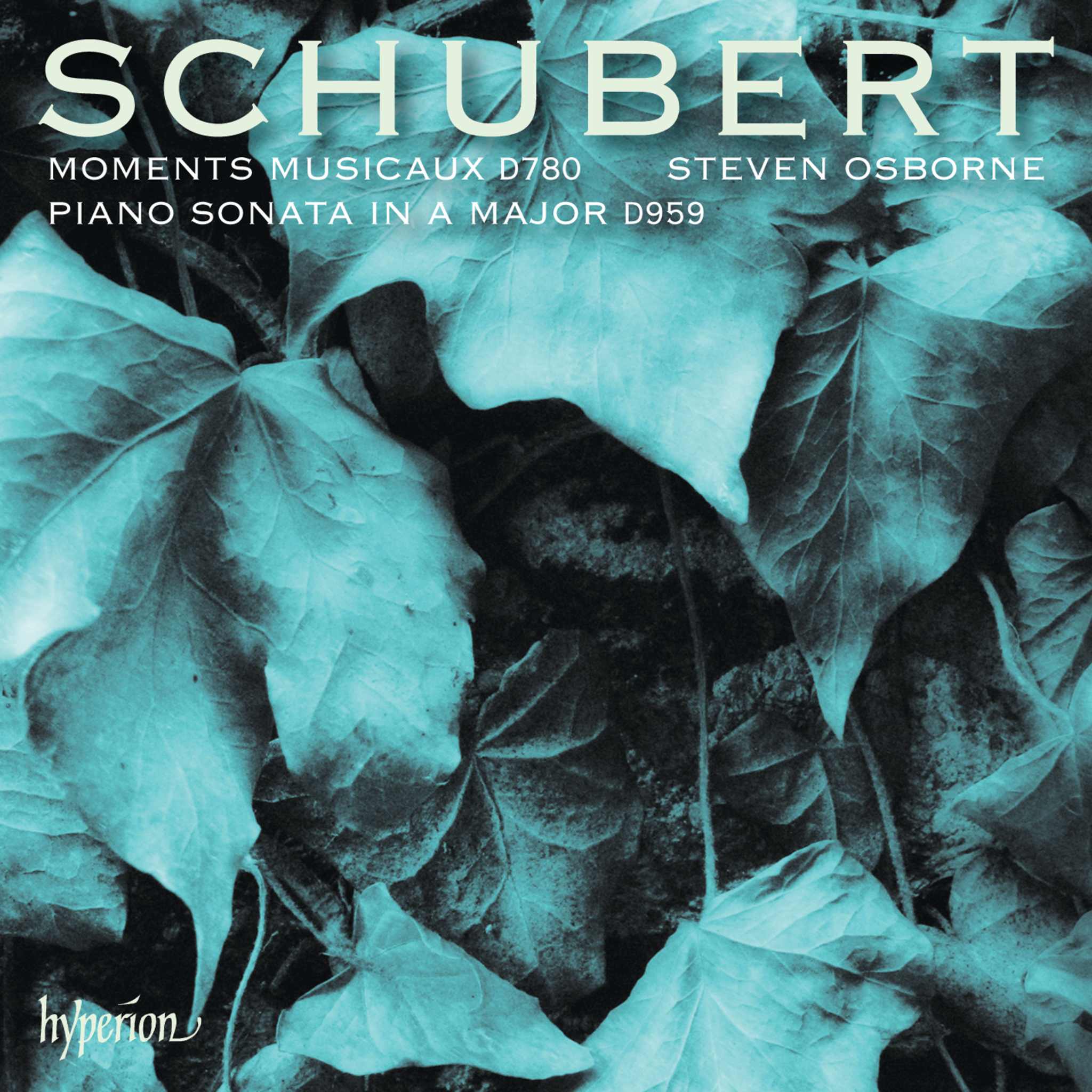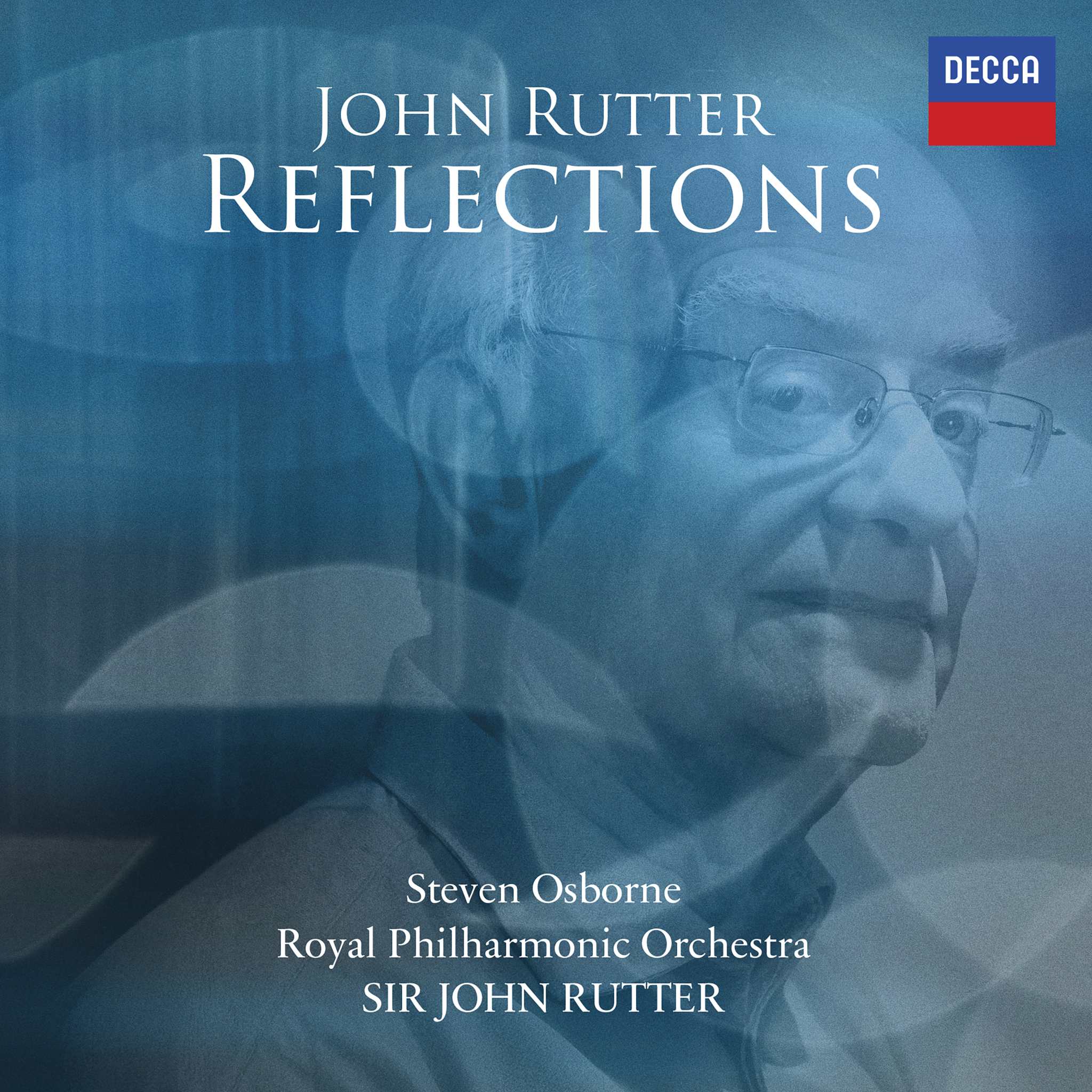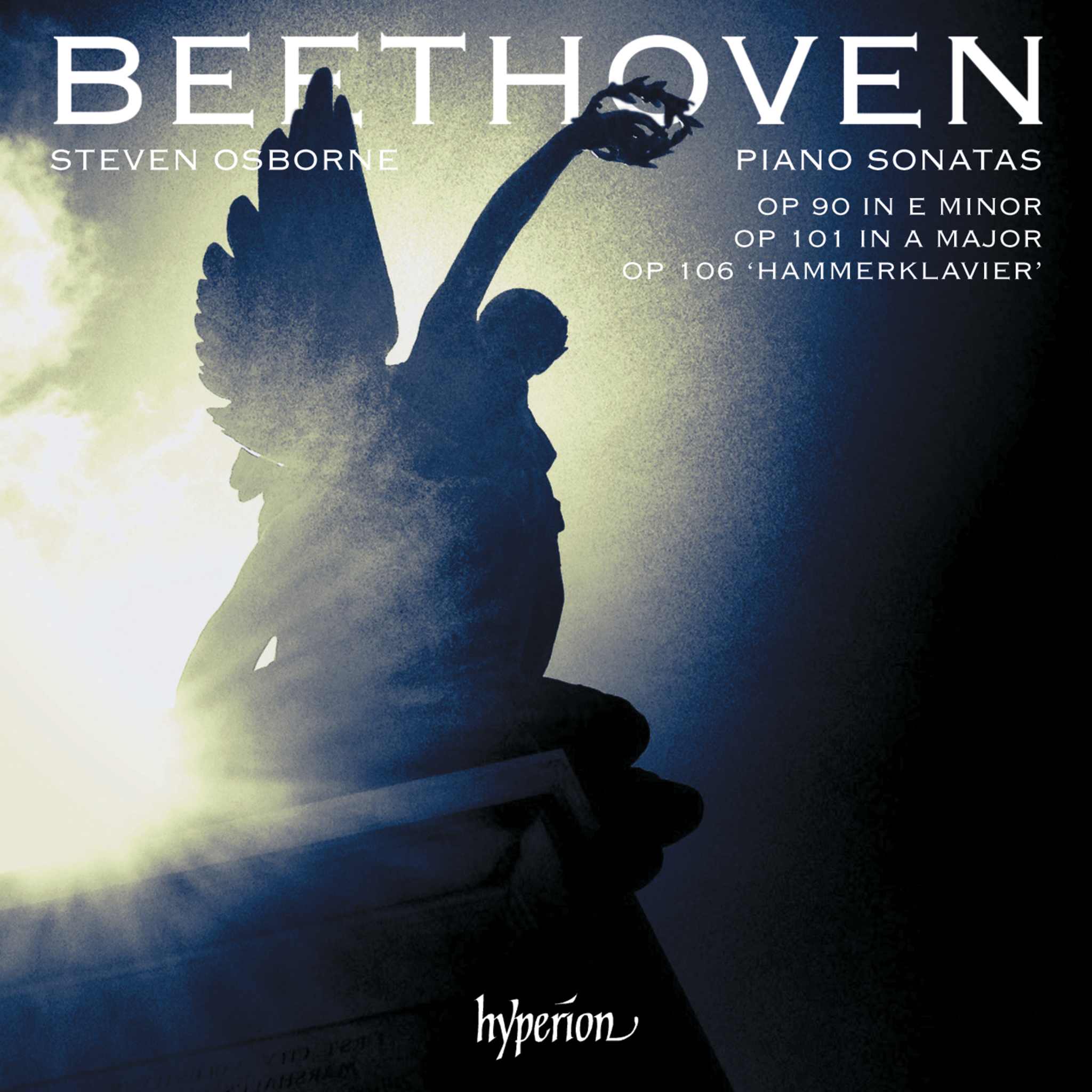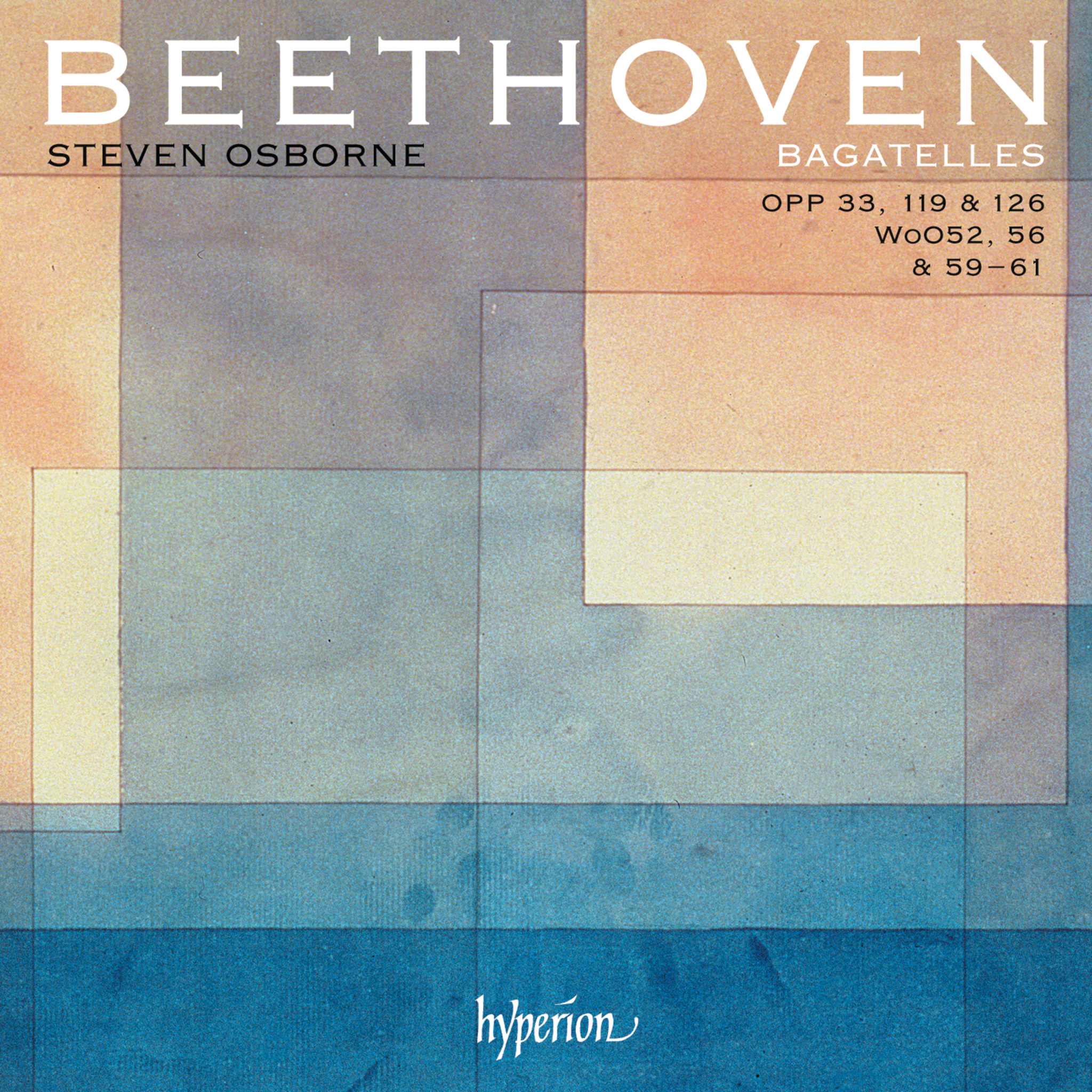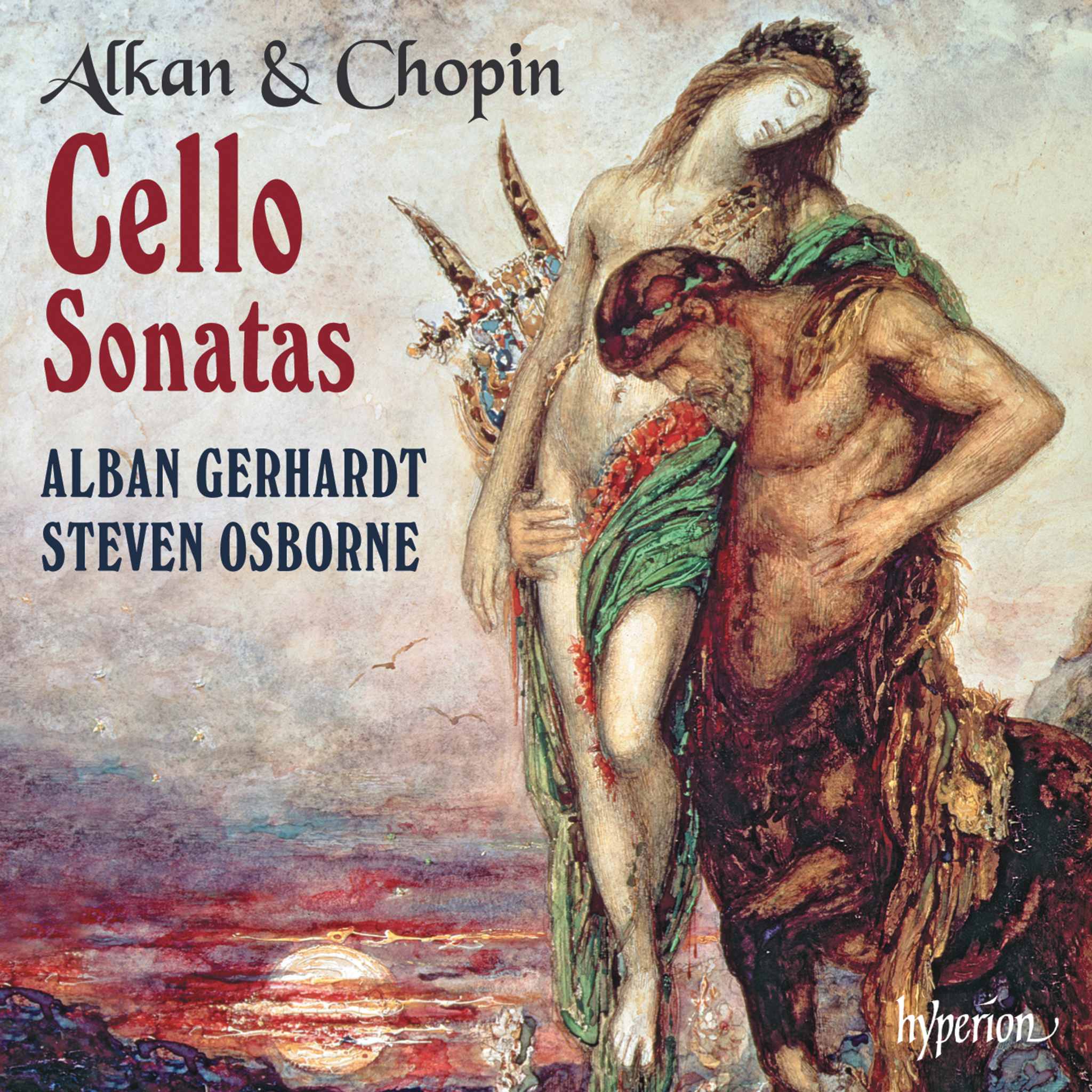Berliner Verlegers Adolf Schlesinger. Anders Viele der frühen Beethoven-Klaviersonaten wurden auf Wunsch von Adelsgönnern in Wien verfasst und erst später gedruckt, als der Musikmarkt zunehmend an Bedeutung gewann.
Die letzten drei Sonaten des Komponisten, Opus 109, 110 und 111, entstanden auf Initiative des Berliner Verlegers Adolf Schlesinger. Anders als frühere Trios erschienen diese Werke eigenständig, wobei die letzten beiden durch Schlesingers Sohn Moritz in Paris veröffentlicht wurden. Sie zeigen eine abwechslungsreiche Kombination aus Dur- und Moll-Tonarten und unterscheiden sich in ihrer Gestaltung deutlich voneinander sowie von anderen Sonaten Beethovens. Opus 109 hatte Beethoven bereits begonnen, bevor Schlesinger ihn um neue Kompositionen bat; ursprünglich schrieb er den ersten Satz für seinen Freund Friedrich Starke, änderte jedoch seine Absicht und fügte ihn in eine Sonate für Schlesinger ein. 1821 wurde sie mit einer Widmung an Maximiliane Brentano veröffentlicht. Der erste Satz, ein technisch vielschichtiges Übungsstück, ist durch unterschiedliche Themen und Tempi geprägt, während das Finale Variationen aufweist, die subtil und eindrucksvoll ausgeführt sind. Die As-Dur-Sonate, Opus 110, entstand nach einer intensiven Arbeitsphase an der Missa solemnis; Beethoven überarbeitete den komplexen dritten Satz mehrmals, bevor er ihn im August 1821 vollendete. Das Finale enthält Rezitative, eine Fuge sowie eine kraftvolle Schlussgestaltung und demonstriert Beethovens Beherrschung dynamischer Kontraste. Opus 111 wurde fast gleichzeitig mit Opus 110 komponiert und stellt hohe technische Ansprüche an die Interpretation. Der erste Satz beginnt dramatisch und führt in ein leidenschaftliches Allegro, während der zweite Satz, die „Arietta“, das Thema in verschiedenen Metren variiert. Die Sonate endet mit einer ausdrucksvollen Coda, die das Sonatenschaffen Beethovens abschließt. Schlesinger bat vergeblich um einen zusätzlichen Finalsatz, doch Beethoven lehnte weitere Kompositionen ab.