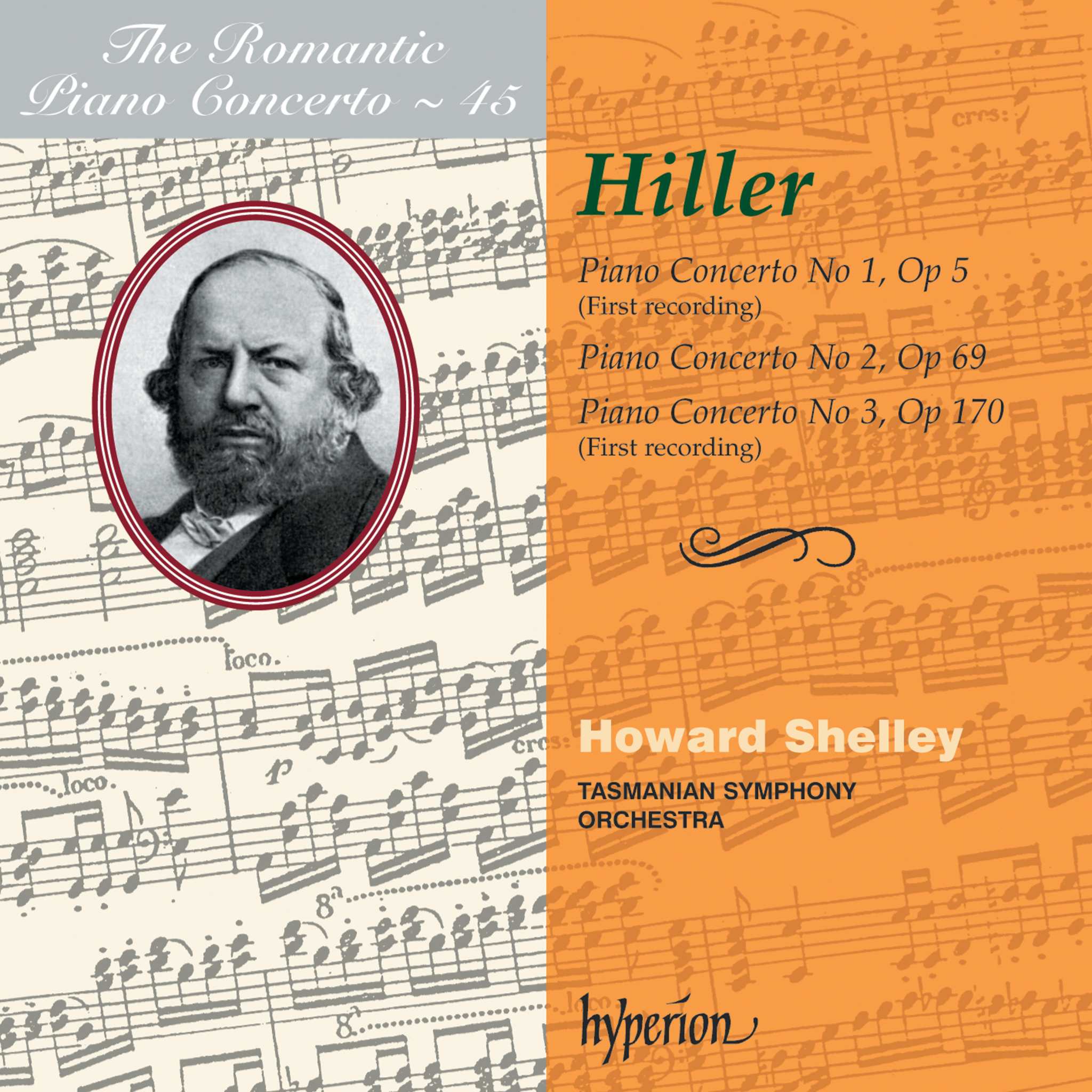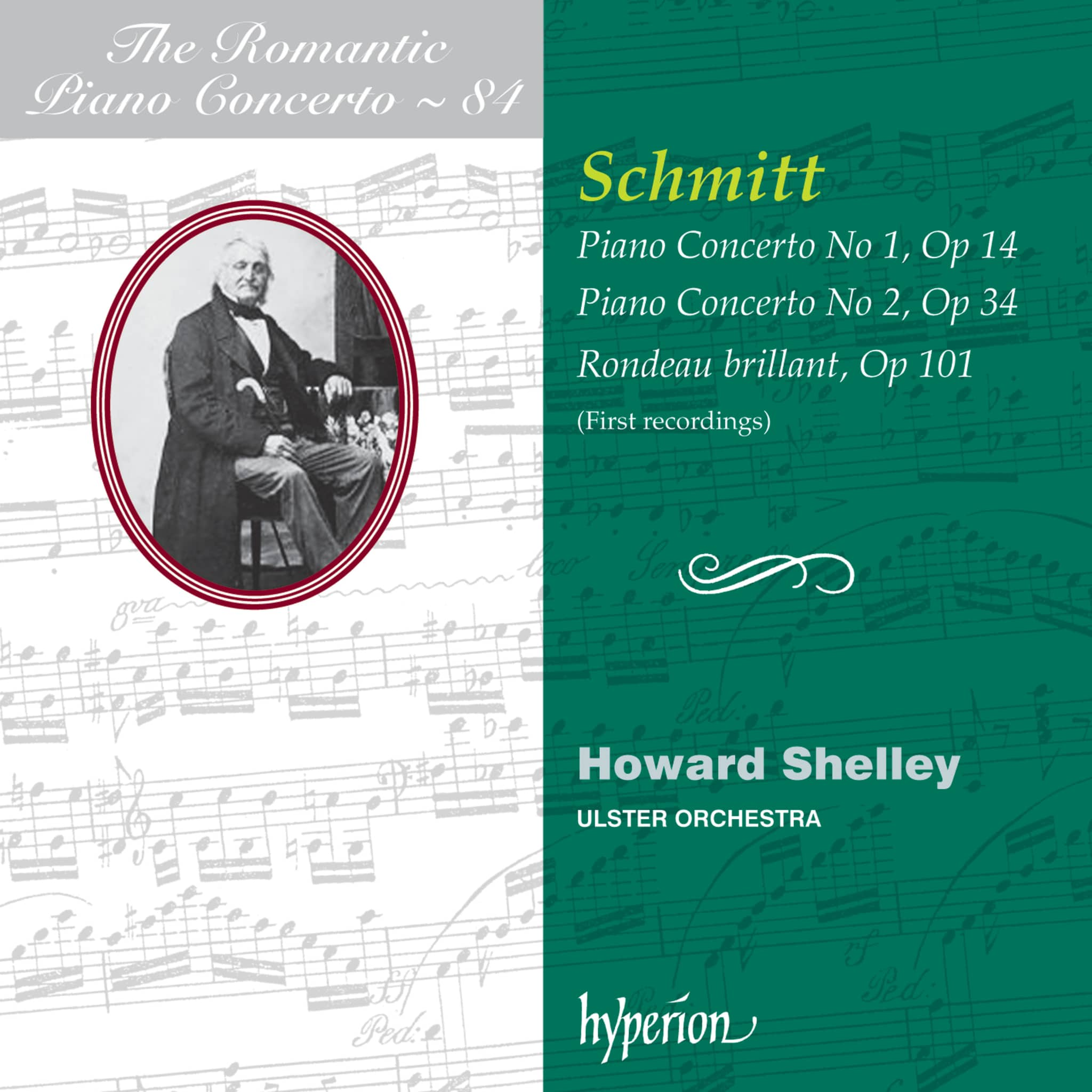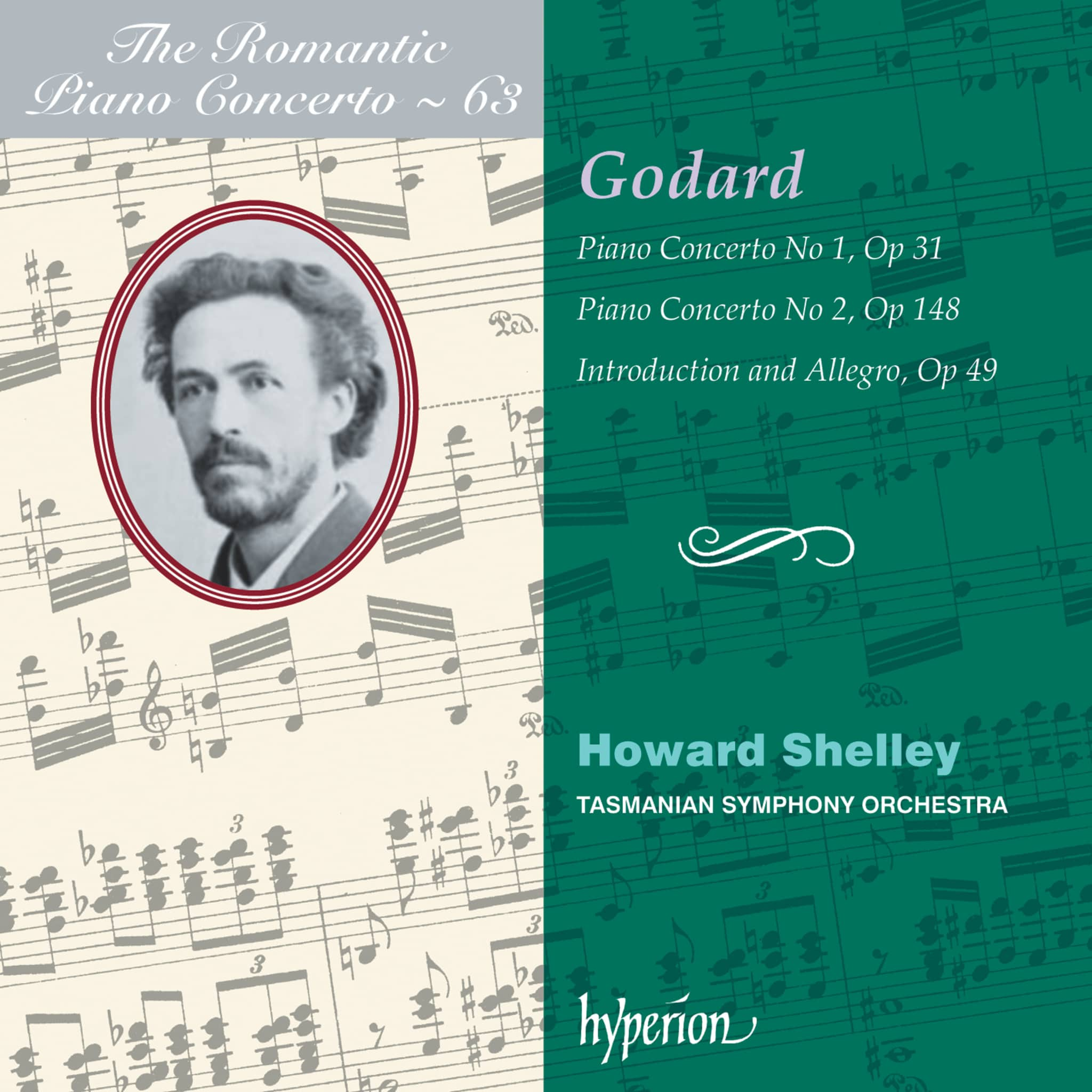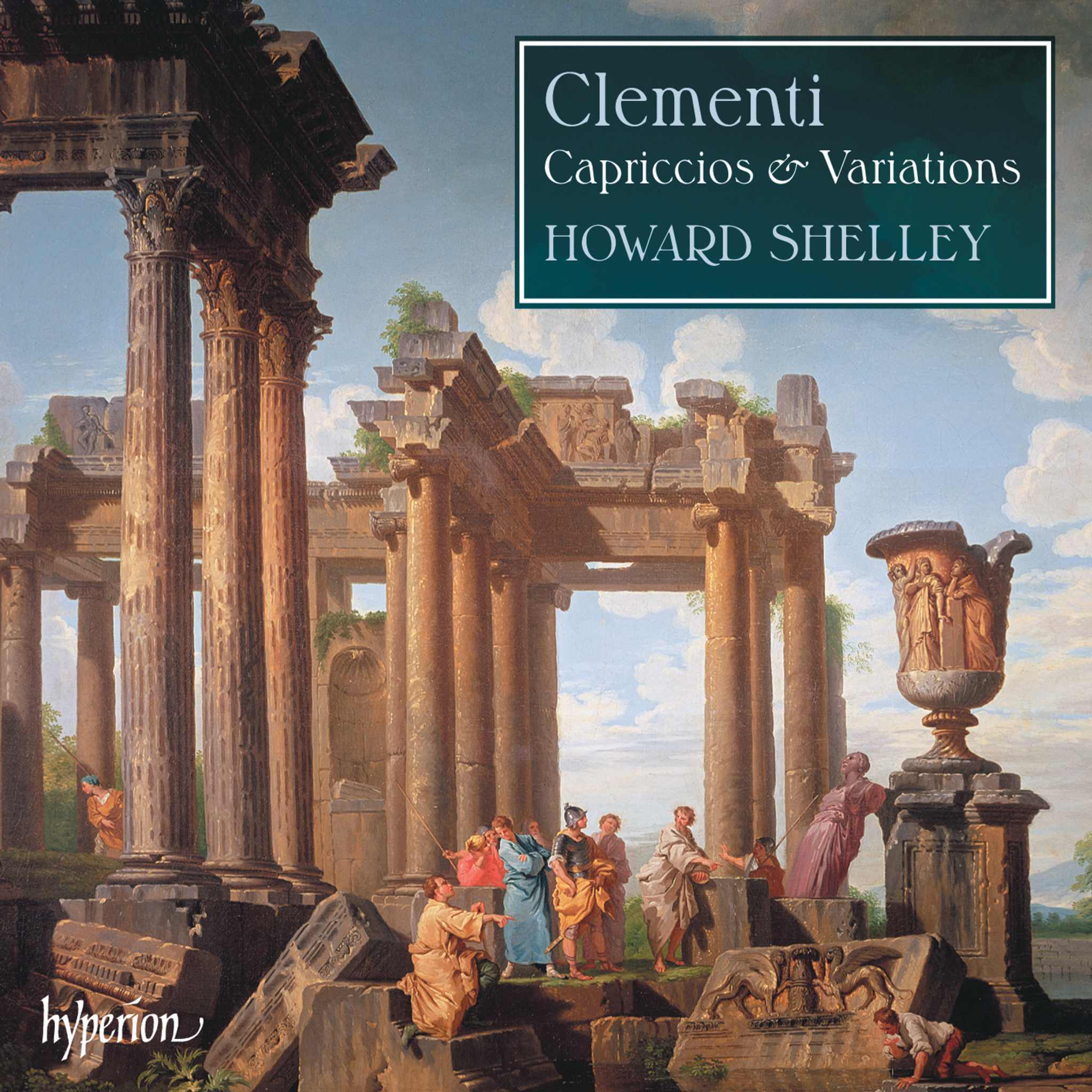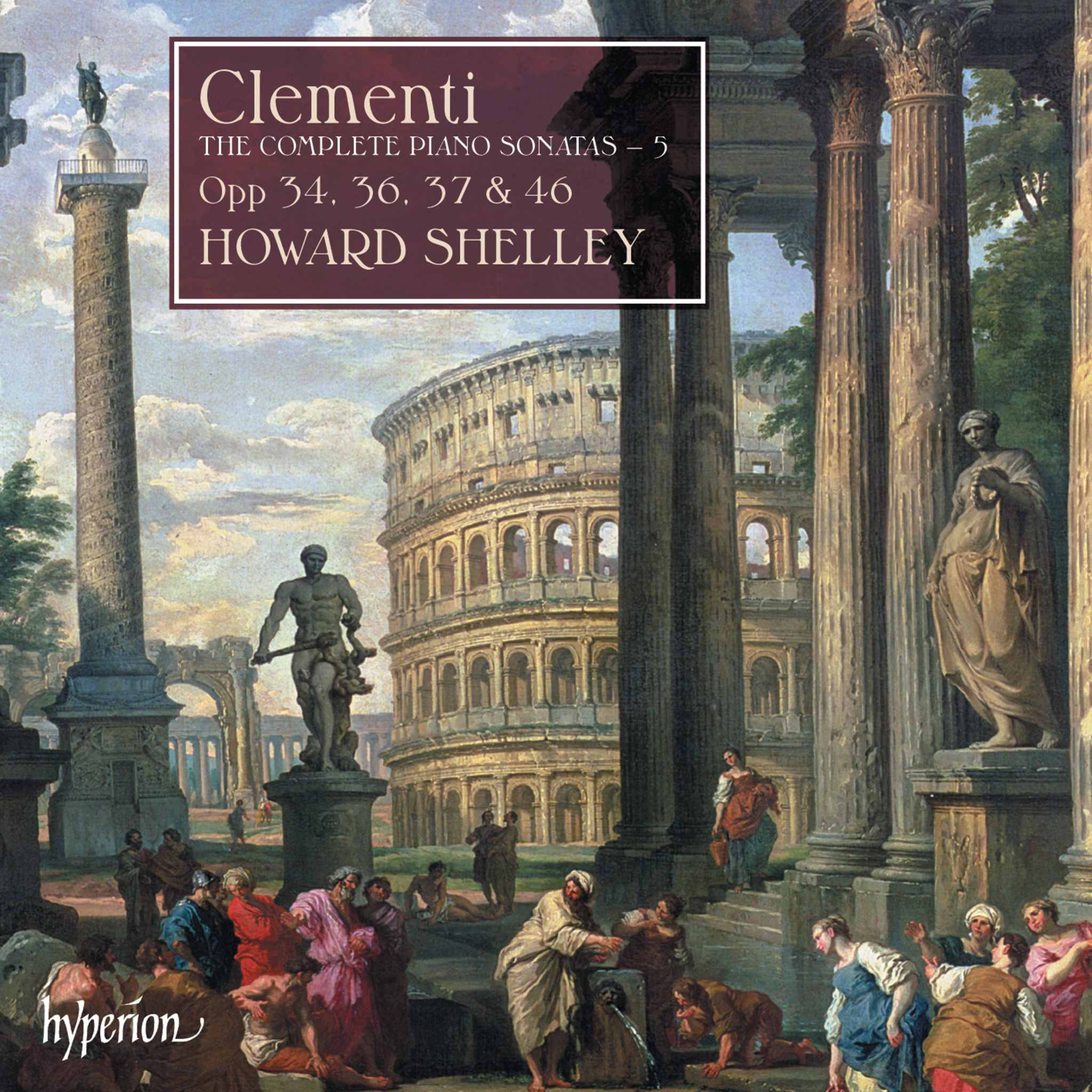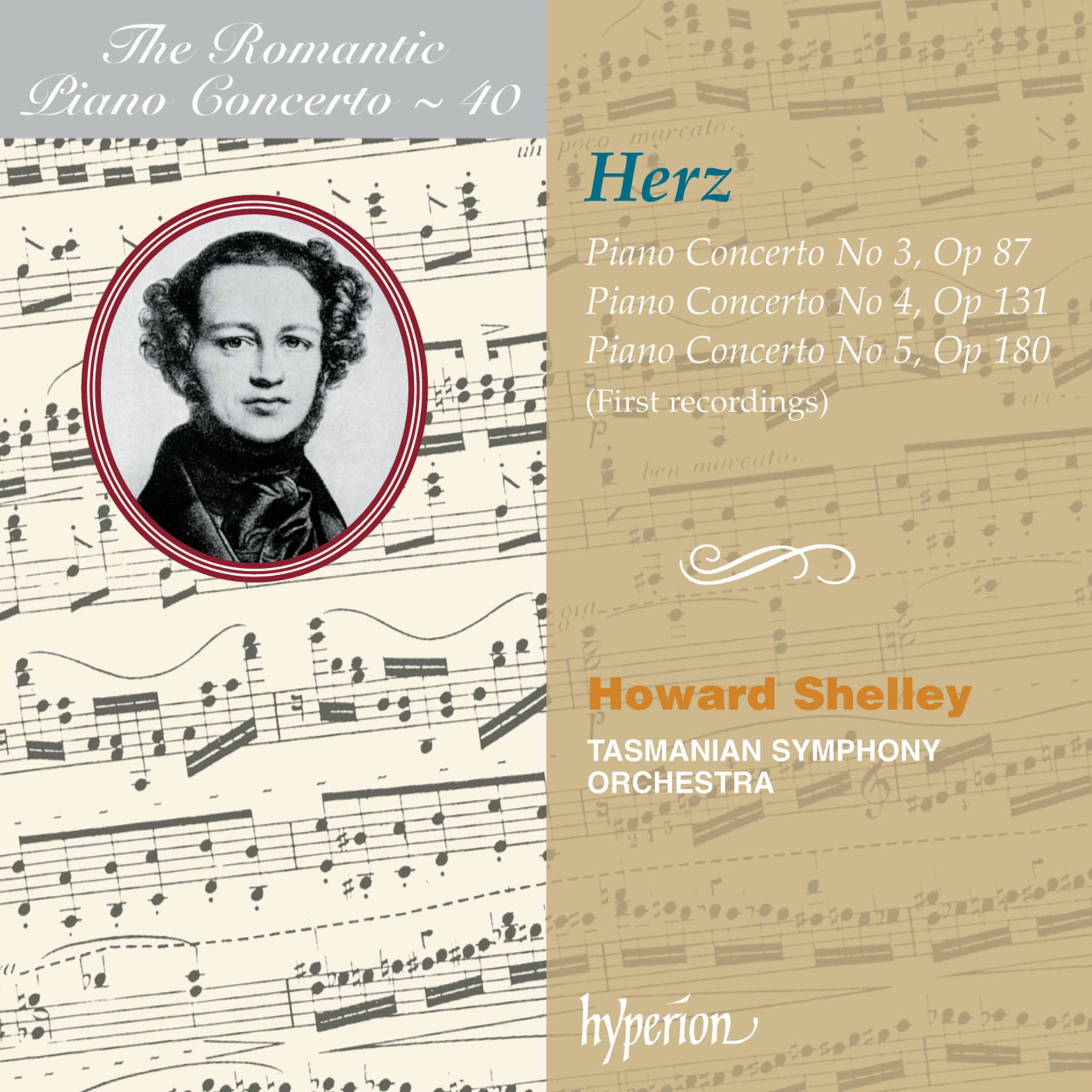Luigi Cherubini Am 24. Oktober 1811 kam Ferdinand Hiller in Frankfurt am Main als Sohn eines wohlhabenden jüdischen Kaufmanns zur Welt. Schon früh zeigte er außergewöhnliche musikalische Begabung und wurde als Wunderkind gefeiert. Seine Laufbahn entwickelte sich rasch: Er machte sich einen Namen als Klaviervirtuose, Komponist, Dirigent und Musikschriftsteller und zählt zu den einflussreichsten Musikerpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, vergleichbar mit Mendelssohn Bartholdy[5].
Nach 1828 hielt sich Hiller längere Zeit in Paris auf, wo er bedeutende Kontakte zu führenden Musikern seiner Epoche knüpfte, von Luigi Cherubini gefördert wurde und enge Freundschaften mit namhaften Komponisten schloss[5]. Weitere berufliche Stationen führten ihn unter anderem nach Düsseldorf und Köln. In Köln prägte er das Musikleben maßgeblich, schuf wichtige Werke für Klavier und Orchester sowie zahlreiche kammermusikalische Kompositionen[4].
Seine drei Klavierkonzerte spiegeln seine intensive Beschäftigung mit der Gattung wider und zeichnen sich durch musikalischen Anspruch aus. Obwohl die Klavierparts für ihre Virtuosität bekannt sind, vermied Hiller oberflächliche Effekte und wurde schon früh für seine durchdachte kompositorische Gestaltung anerkannt. Seine Werke für Klavier und Orchester bereichern das 19. Jahrhundert um herausragende Beiträge zur Klavierkonzertliteratur und belegen sein Streben nach künstlerischer Tiefe und Ausdrucksstärke.