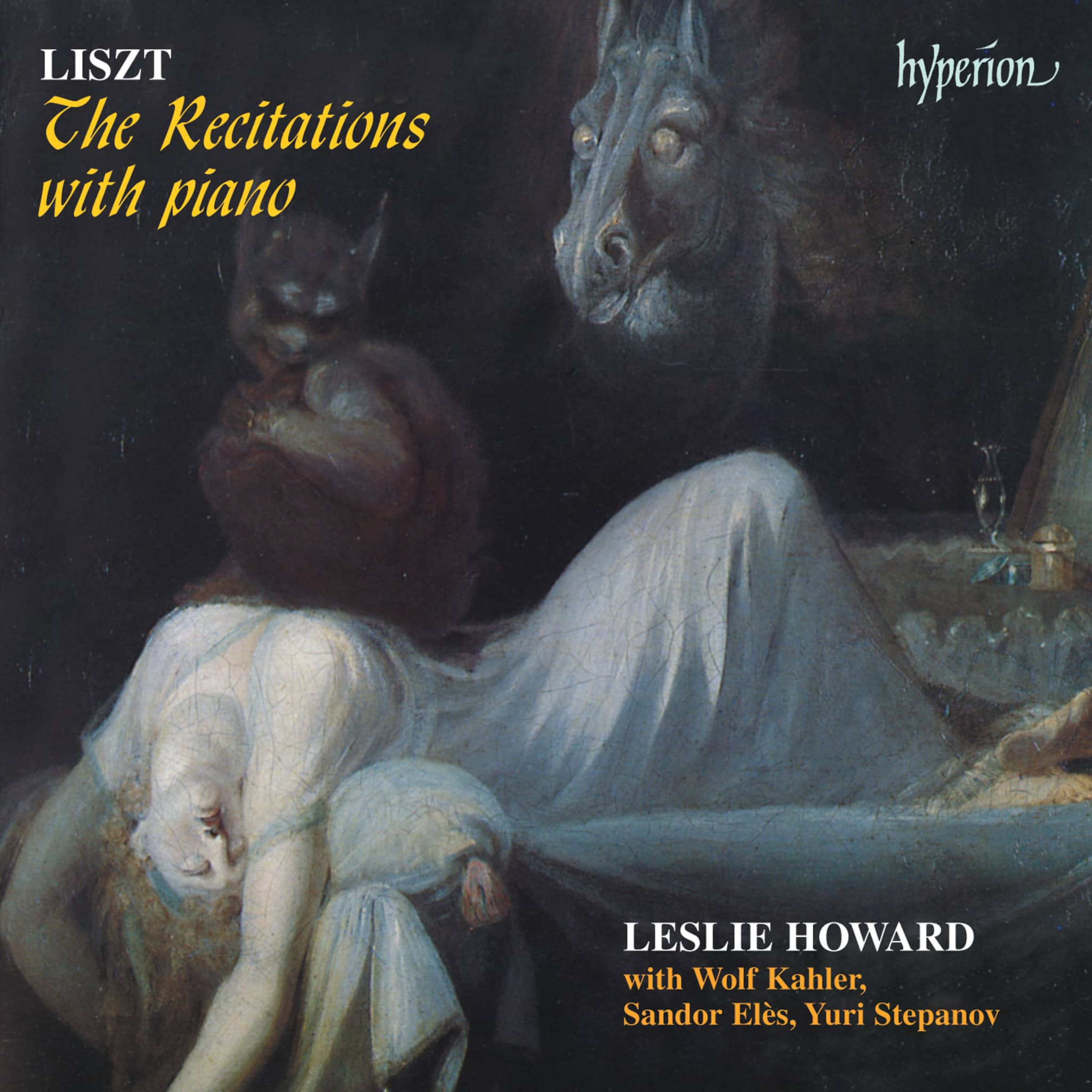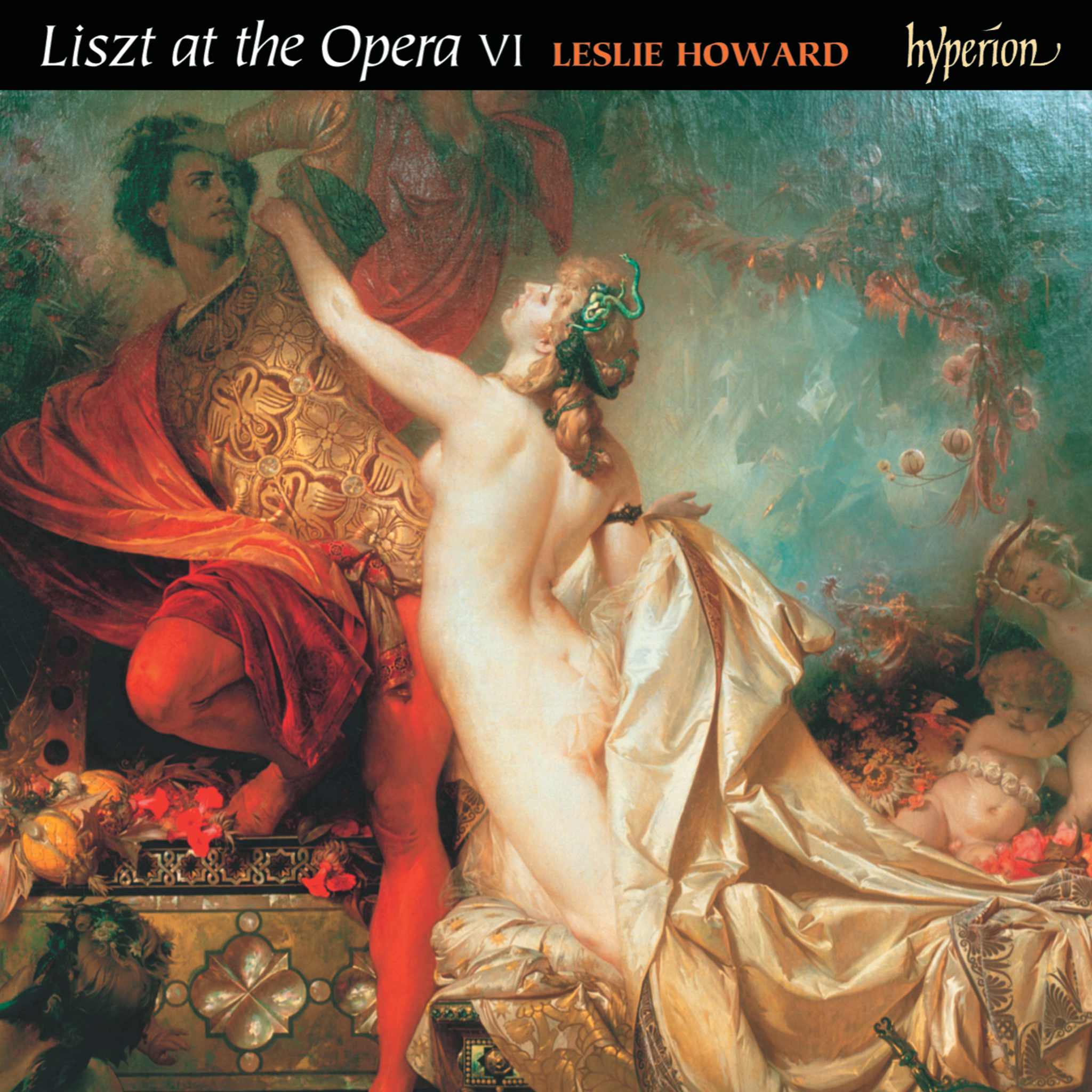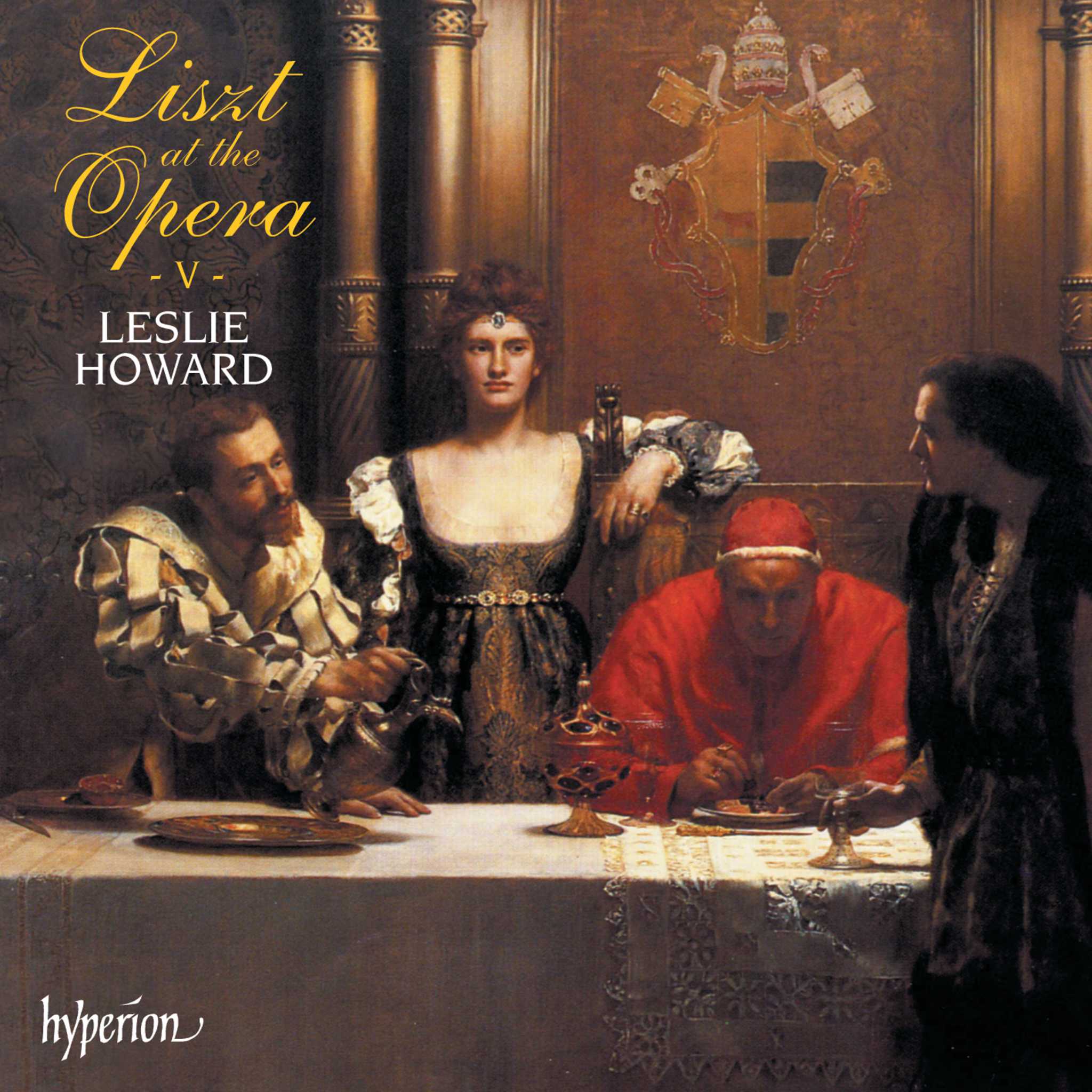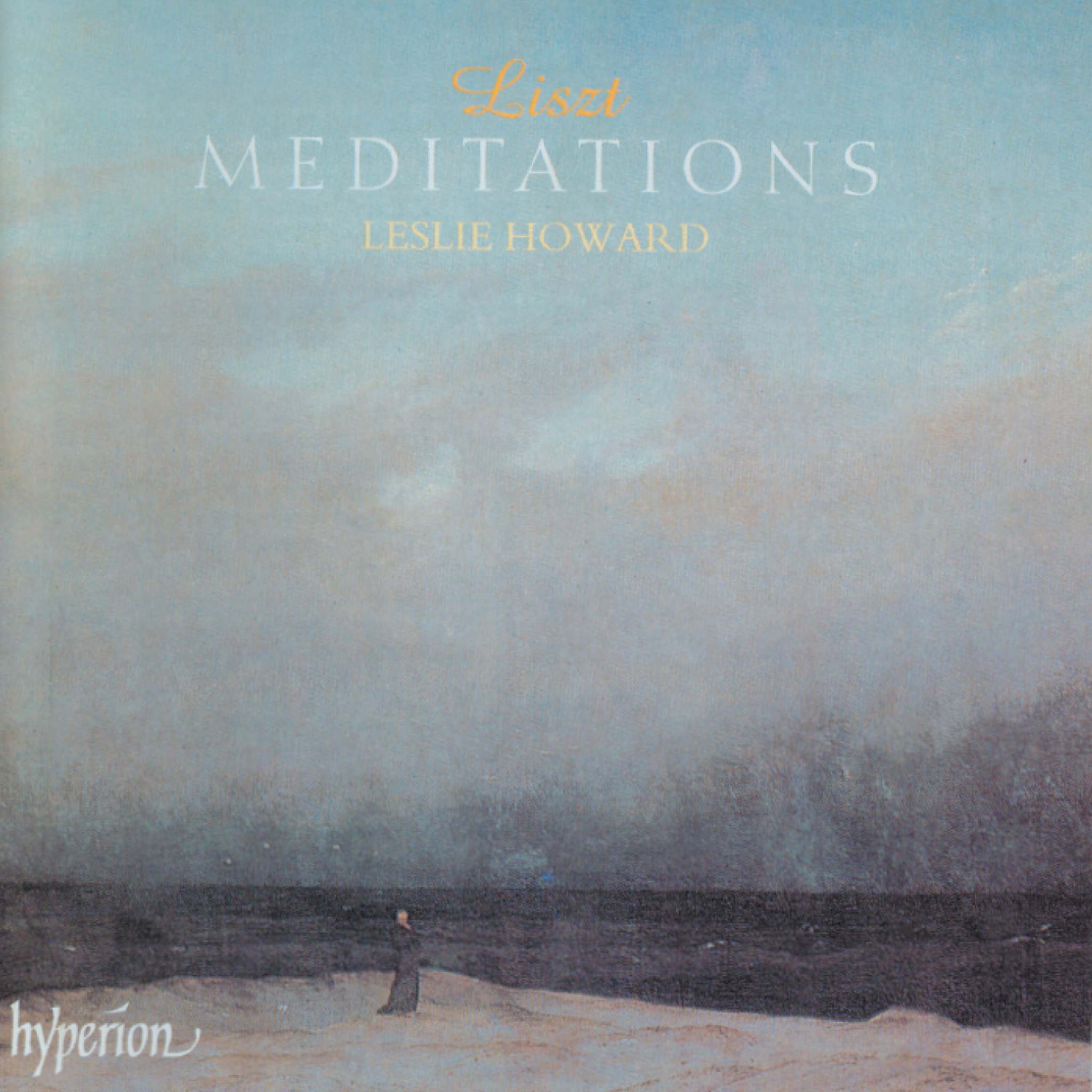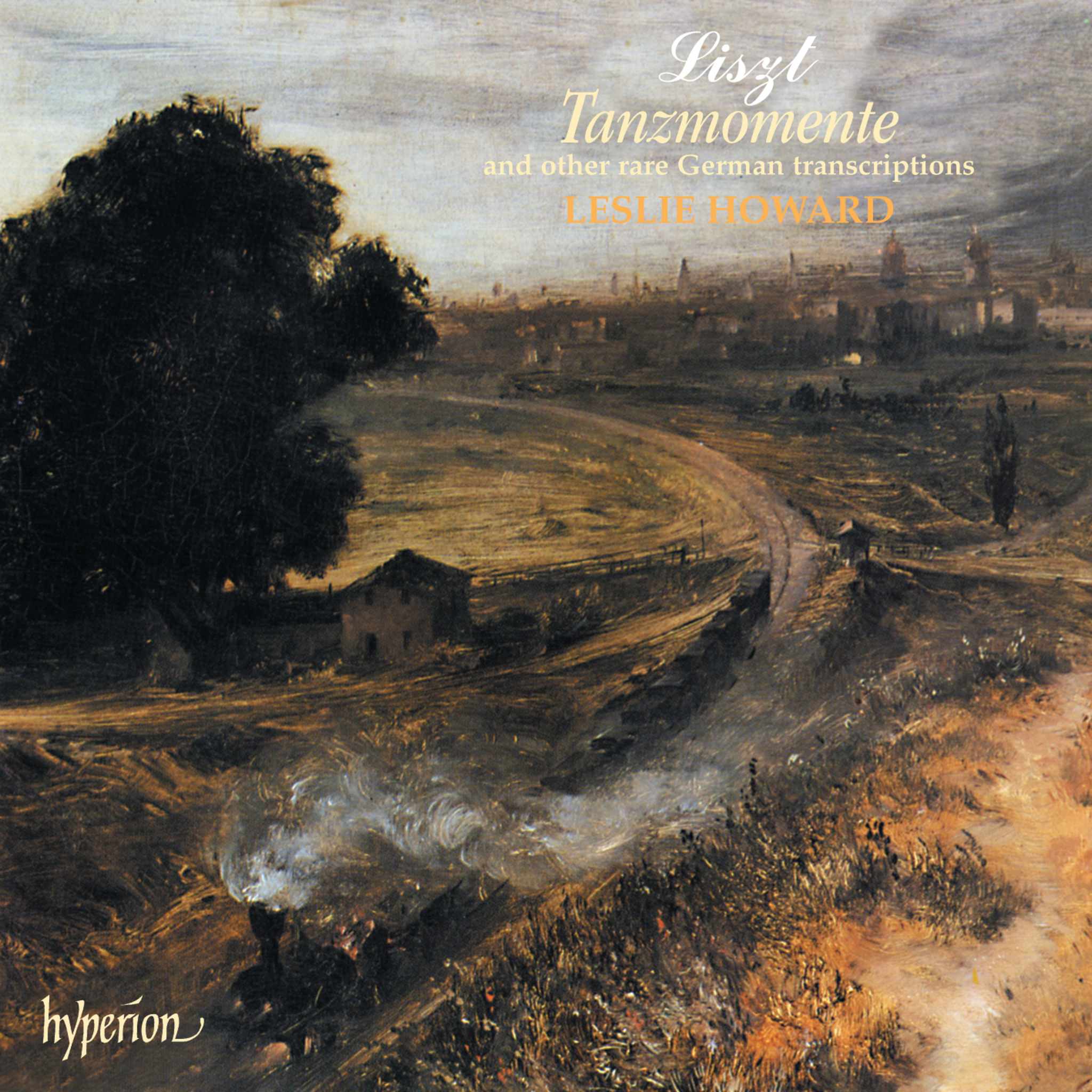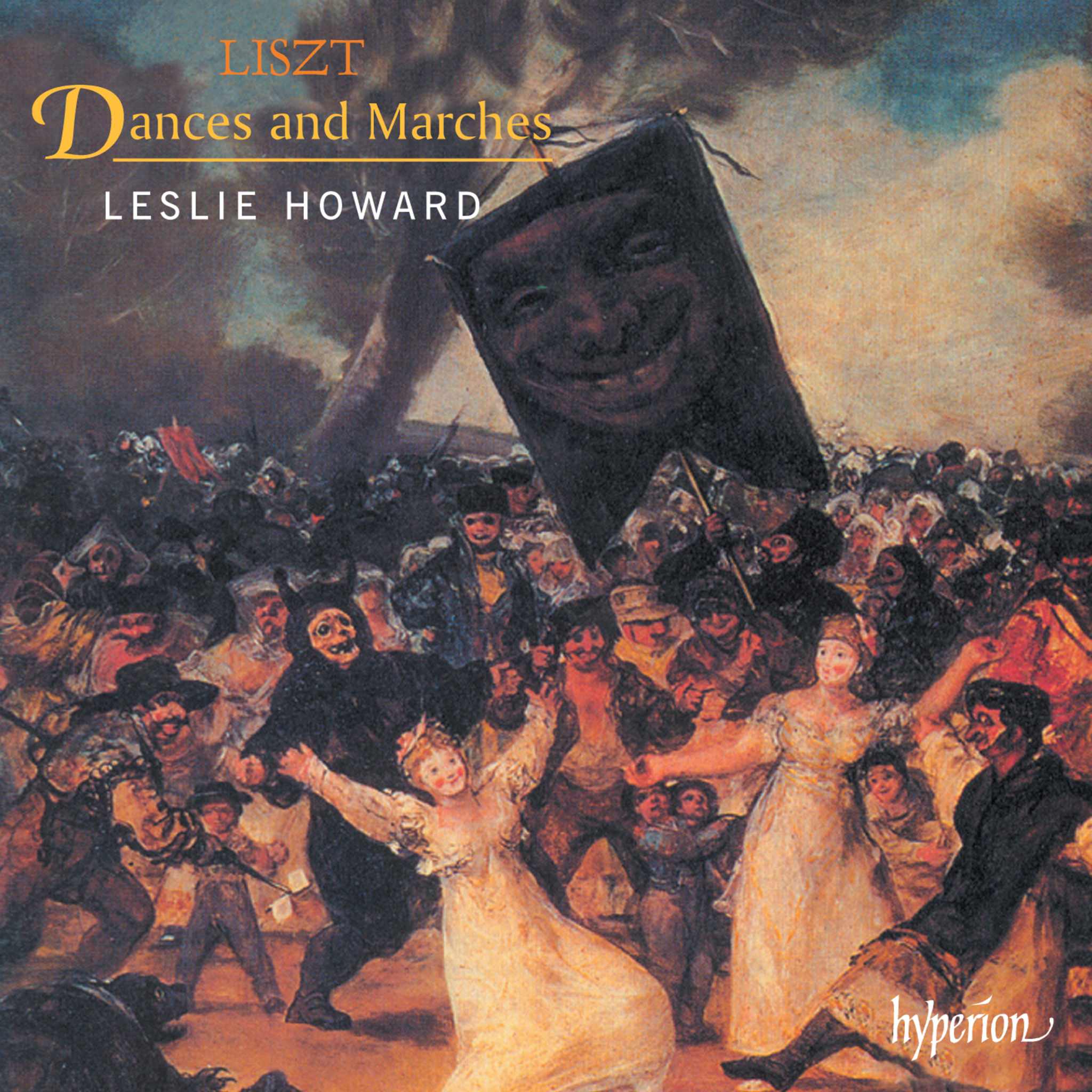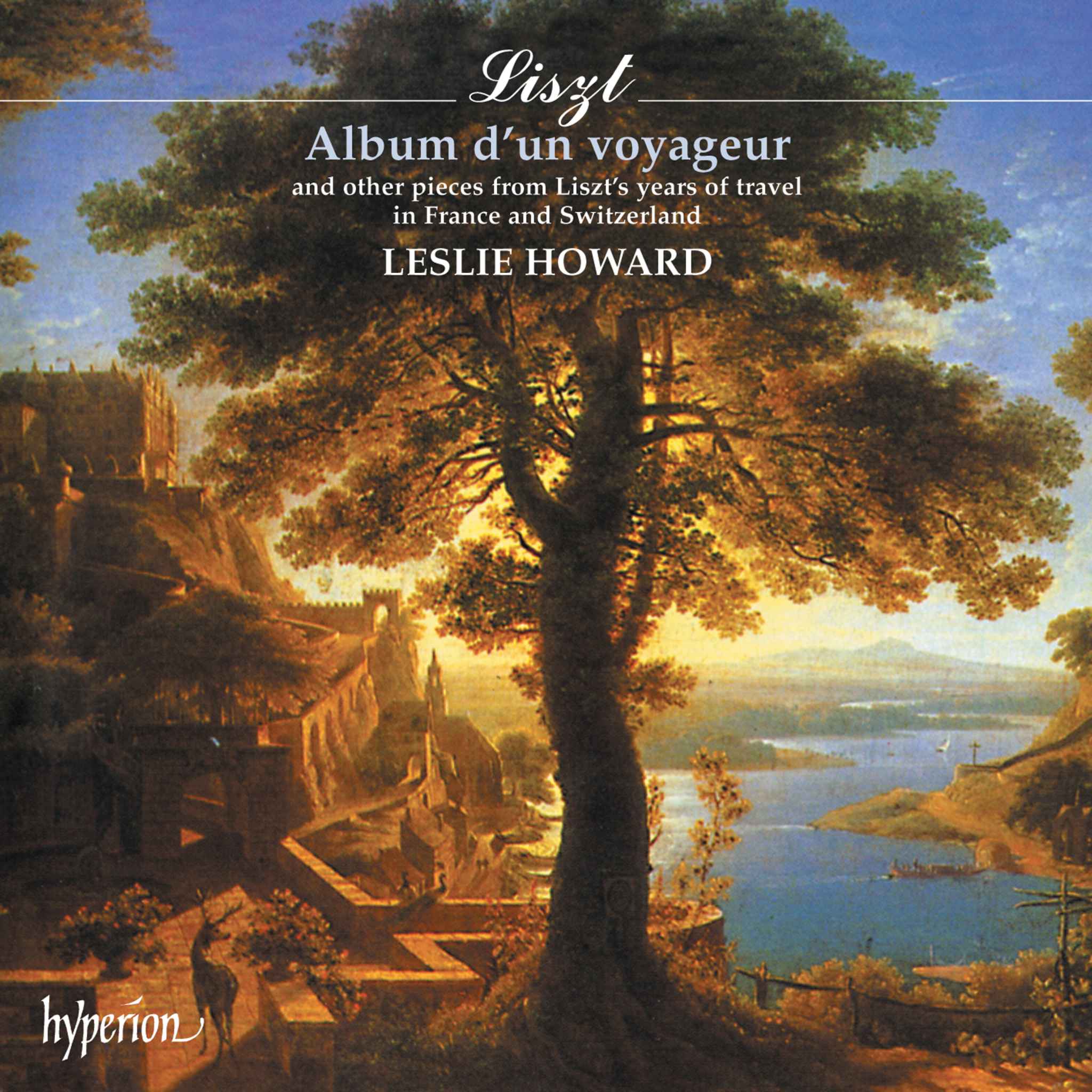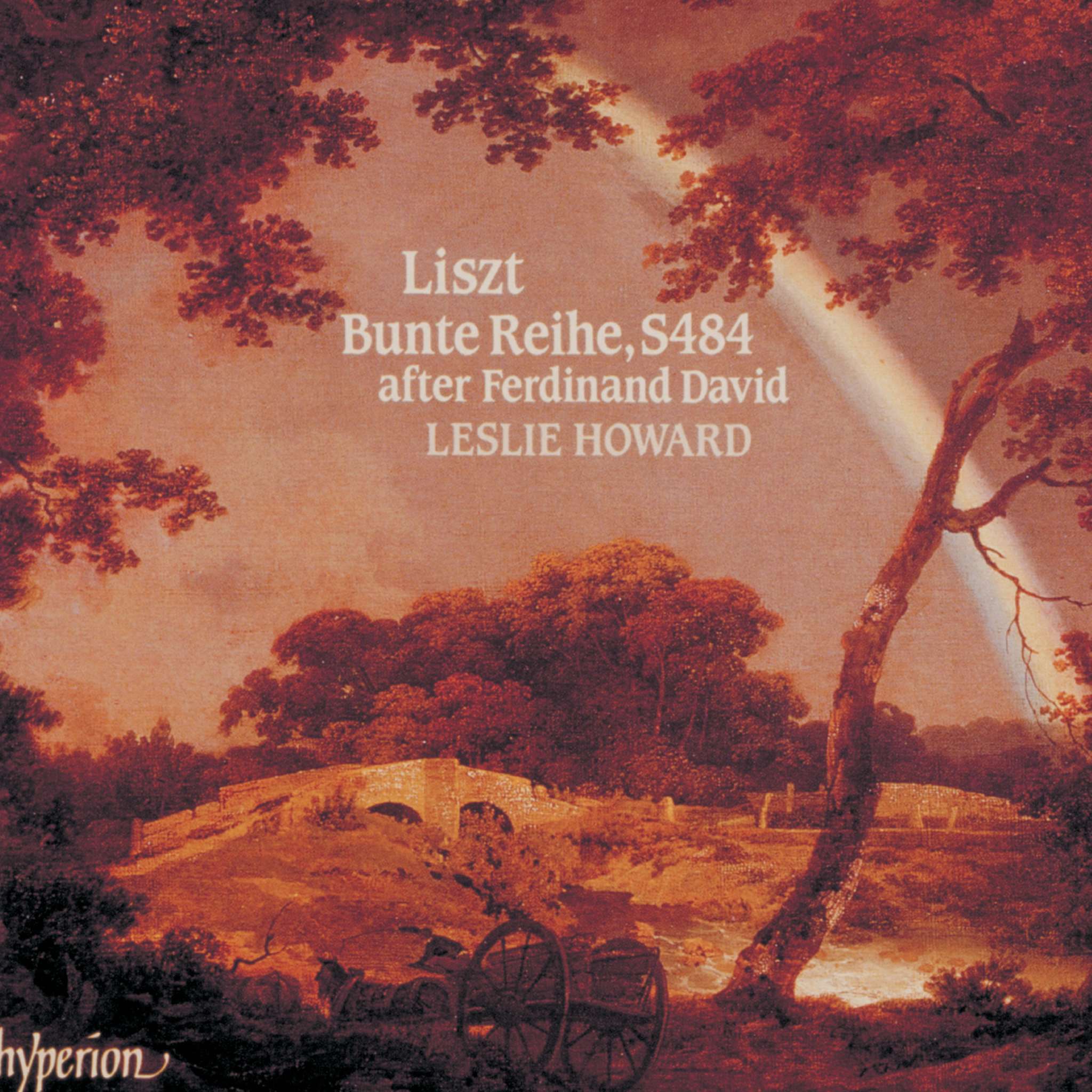Im 19. Jahrhundert erfreute sich das Melodrama im Salon mit instrumentaler Untermalung großer Beliebtheit und hatte seine Ursprünge in Oper und Singspiel. Die Verbindung von Rezitation und Klavierbegleitung wurde von Komponisten wie Schubert und Richard Strauss erkundet. Das umfangreichste Werk dieser Art war Strauss' Vertonung von Tennysons "Enoch Arden", während Graham Johnson Schuberts "Abschied von der Erde" für Hyperion zusammenstellte. Unter Liszts fünf komponierten Melodramen befinden sich "Lenore" und "Der traurige Mönch". Diese Werke werden hier dokumentiert, da sie nur Klavier als Begleitinstrument verwenden, um sie vor dem Vergessen zu bewahren.
Bürgers "Lenore" diente nicht nur als Inspiration für Raffs Fünfte Symphonie, sondern auch für Liszts "Lenore - Ballade". Mit der Vertonung von Nicolaus Lenaus "Der traurige Mönch" zeigte Liszt erste Anzeichen seiner späteren musikalischen Entwicklung. "Helges Treue", basierend auf Felix Draesekes Werk, blieb bis 1874 unveröffentlicht. Als Liszts herausragendstes Werk in ungarischer Sprache gilt "A holt költö szerelme", eine Vertonung von Mór Jókais Gedicht über Sándor Petöfi. Das einzige russischsprachige Werk Liszts war die Vertonung von Graf Alexey Konstantinovich Tolstoys "Weis mich nicht ab, mein Freund", das später zu einem Solostück für Klavier umgearbeitet wurde.