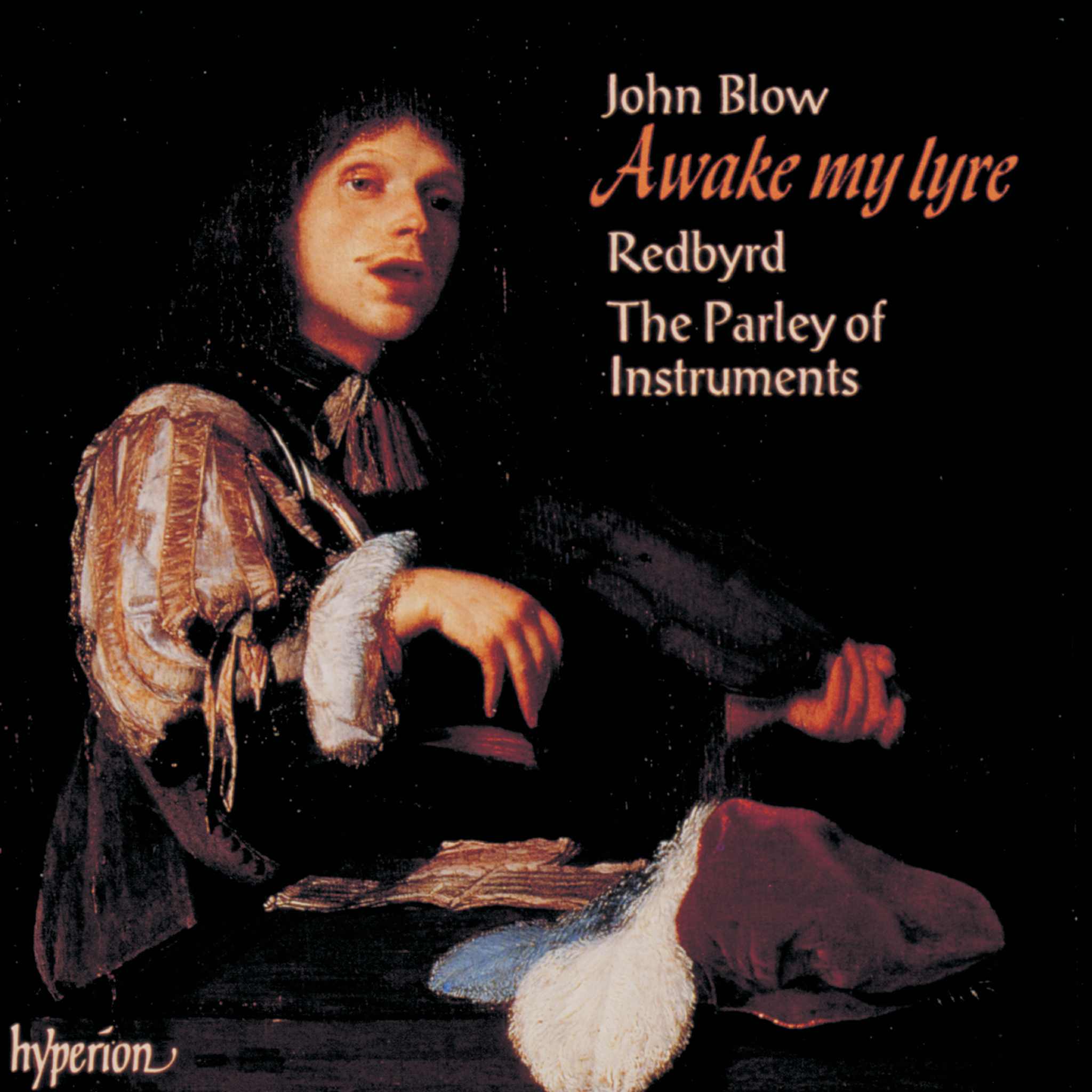Album insights
Samuel Coleridge-Taylor, der am 15. August 1875 in London zur Welt kam, war der Sohn von Daniel Peter Hughes Taylor aus Sierra Leone und der Engländerin Alice Hare Martin. Benannt wurde er nach dem Dichter Samuel Taylor Coleridge. Schon im Kindesalter zeigte er eine außergewöhnliche musikalische Begabung und wuchs im Londoner Stadtteil Croydon auf, wo sein Großvater ihm zunächst das Geigespiel beibrachte und später für seine professionelle Ausbildung sorgte.
Sein musikalischer Werdegang führte ihn 1890 an das Royal College of Music, wo er Komposition bei Charles Villiers Stanford studierte. Während seiner Studienzeit entstanden die Fantasiestücke op. 5 für Streichquartett, die sich durch einen kunstvollen und eher traditionellen Stil auszeichnen. Besonders hervorzuheben sind die Stücke „Serenade“ und „Dance“, in denen sich Anregungen aus Tschaikowskys Sinfonie Nr. 6, insbesondere im Umgang mit ungewöhnlichen Metren, widerspiegeln.
Im Jahr 1900 vollendete Coleridge-Taylor drei Kantaten, die auf Longfellows Epos „The Song of Hiawatha“ basieren; das bekannteste dieser Werke ist „Hiawatha’s Wedding Feast“. Begeistert von Longfellows Dichtung, benannte er sogar seinen Sohn nach dem amerikanischen Autor. Obwohl er 1905 auch eine Rhapsodie zu Coleridges „Kubla Khan“ für Mezzosopran, Chor und Orchester komponierte, lag sein Hauptaugenmerk stets auf Longfellows Werk.
Sein Interesse an amerikanischer Literatur war wenig überraschend, da Coleridge-Taylor stolz auf seine afrikanischen Wurzeln war und häufig Spirituals als Vorlage für eigene Kompositionen nutzte. Zwischen 1904 und 1910 reiste er mehrfach in die USA, wo er als Dirigent eigener Werke – darunter die Hiawatha-Kantaten und „Choral Ballads“ nach Longfellows Gedichten – gefeiert wurde. Die Musiker des New Yorker Orchesters bezeichneten ihn respektvoll als „den afrikanischen Mahler“. In seiner Musik lassen sich künstlerische Verbindungen zu Dvořák erkennen, dessen Einfluss auf sein Schaffen bedeutend war.
Dvořák selbst erhielt im Frühjahr 1891 das Angebot, die Leitung des National Conservatory of Music in New York zu übernehmen. Trotz beruflicher Erfolge in Amerika litt er unter Heimweh und fand nach seiner Rückkehr nach Prag zu neuer Schaffenskraft. Dort entstanden zwei bedeutende Streichquartette: das in As-Dur, op. 105, und das in G-Dur, op. 106, in denen Dvořák sowohl seine amerikanischen Erlebnisse als auch seine emotionale Bindung zur Heimat verarbeitete.
Gerade das G-Dur-Quartett spiegelt die Erfahrungen Dvořáks in Amerika wider; seine Sätze sind von Wärme und Melancholie geprägt und zeichnen sich durch originelle melodische und rhythmische Elemente aus. Variationen und Weiterentwicklungen der Themen belegen Dvořáks Fähigkeit, anspruchsvolle Musik mit erzählerischer Klarheit zu verbinden.
Schließlich gestaltete Dvořák ein früheres a-Moll-Quartett zu einem einheitlichen Werk um, das durch seinen unverwechselbaren Charakter besticht. Trotz einer Phase der Selbstkritik gelang es ihm, das Stück mit einem eindrucksvollen Adagio in E-Dur abzuschließen, das sowohl seine kompositorische Meisterschaft als auch seine emotionale Tiefe eindrucksvoll demonstriert.