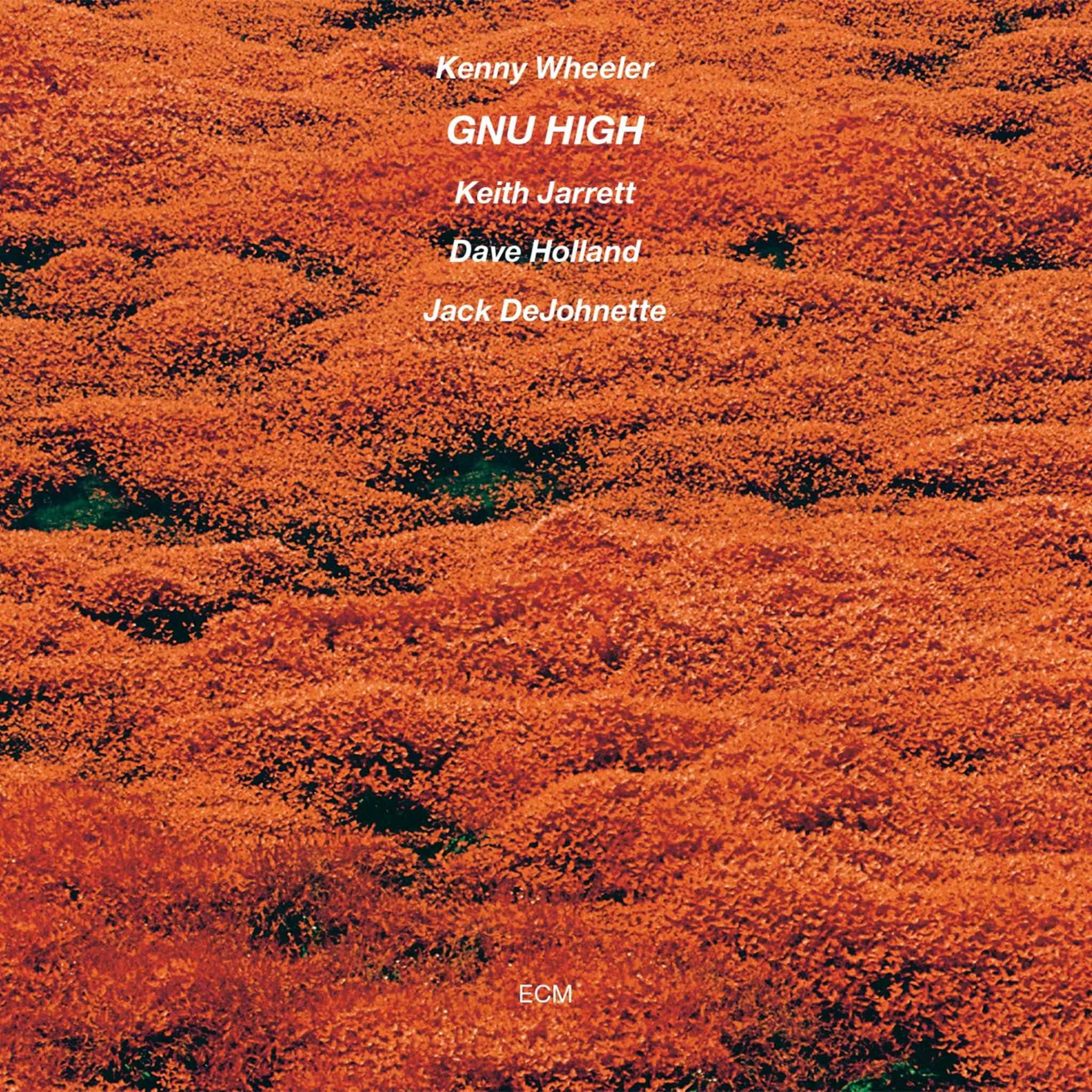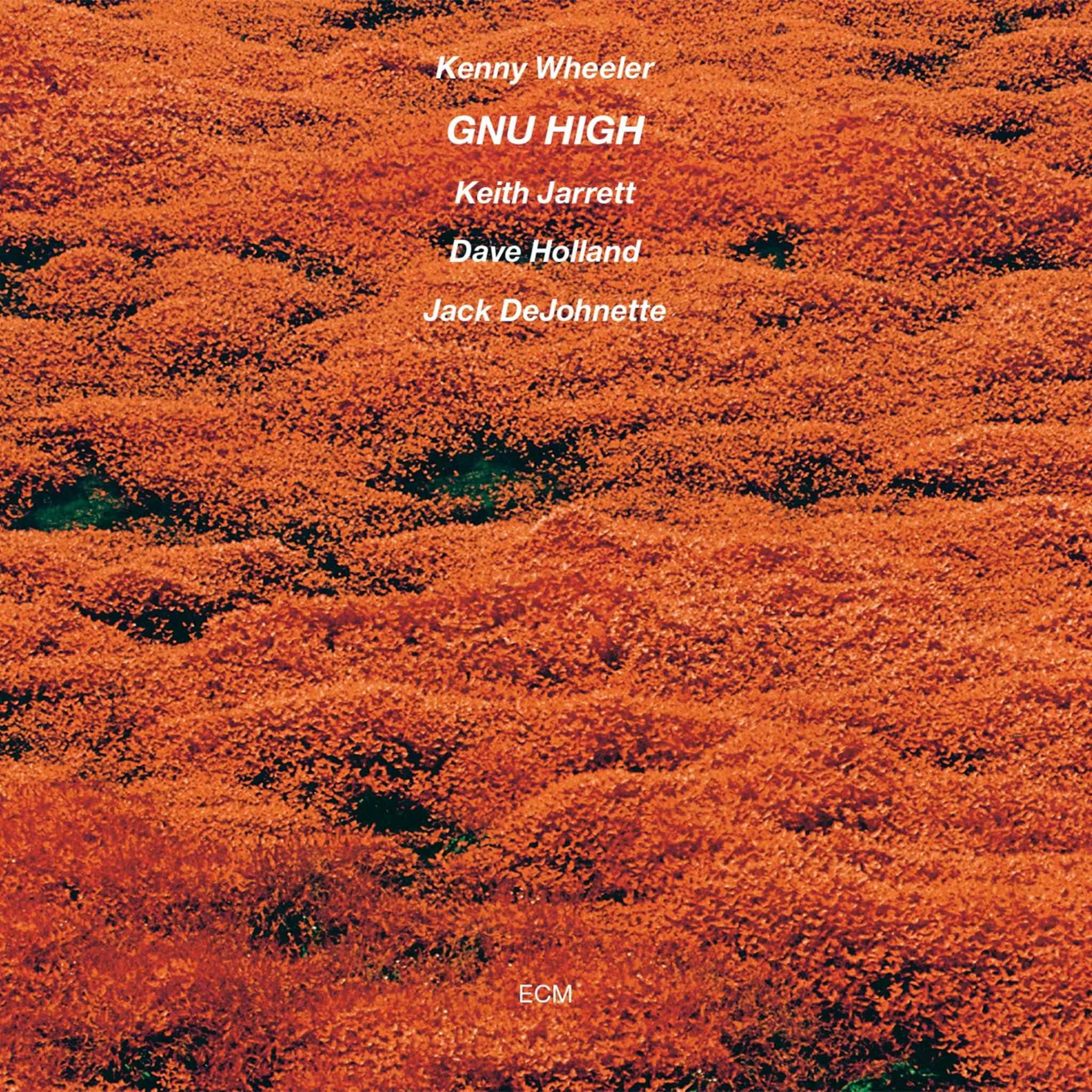Kenny Wheelers faszinierendes ECM-Debüt als Bandleader, "Gnu High", entstand im Jahr 1975 in New York und wurde von Manfred Eicher produziert. Die Neuauflage auf Vinyl erscheint in der audiophilen Luminessence-Serie. Auf dem Album führt Kenny Wheeler ein herausragendes Quartett an, zu dem Keith Jarrett, Dave Holland und Jack DeJohnette gehören. Die Musik besticht durch eine leidenschaftliche Darbietung und eine tiefgründig lyrische Kompositionsweise, die Wheeler internationale Anerkennung verschaffte. Die vier Musiker gelten als exzellente Improvisatoren, deren gemeinsames musikalisches Verständnis in den Bands von Miles Davis gewachsen ist. Jack DeJohnette hebt hervor, dass die Spontaneität des Augenblicks in den Aufnahmen deutlich hörbar ist. Dave Holland betont, wie gelungen die Verbindung von Kennys melodischen und harmonischen Strukturen mit einer freien Interpretationsweise umgesetzt wurde. Das Klappcover der Platte enthält zudem neue Liner Notes von Nick Smart, einem engen Freund, Kollegen und Biografen von Kenny Wheeler.