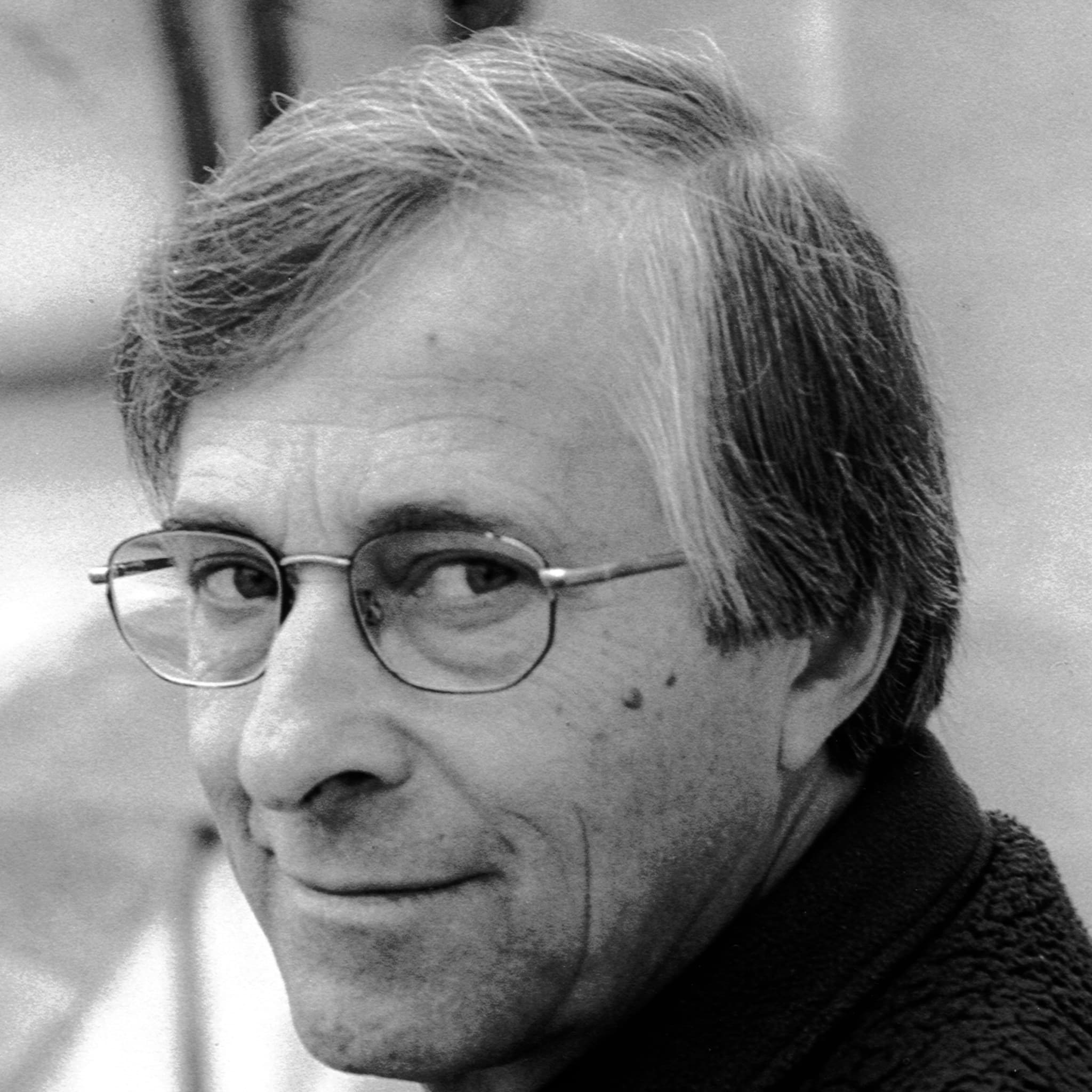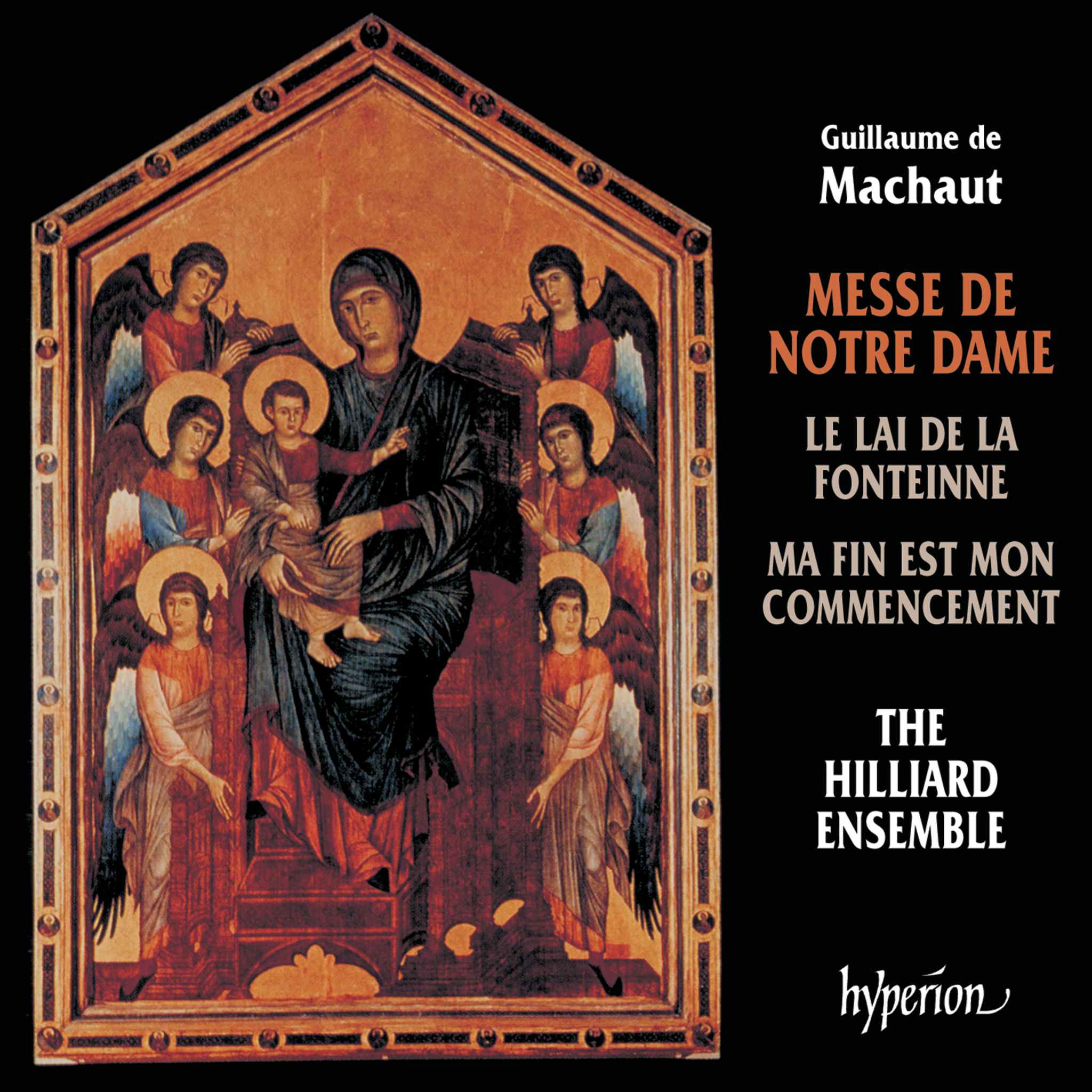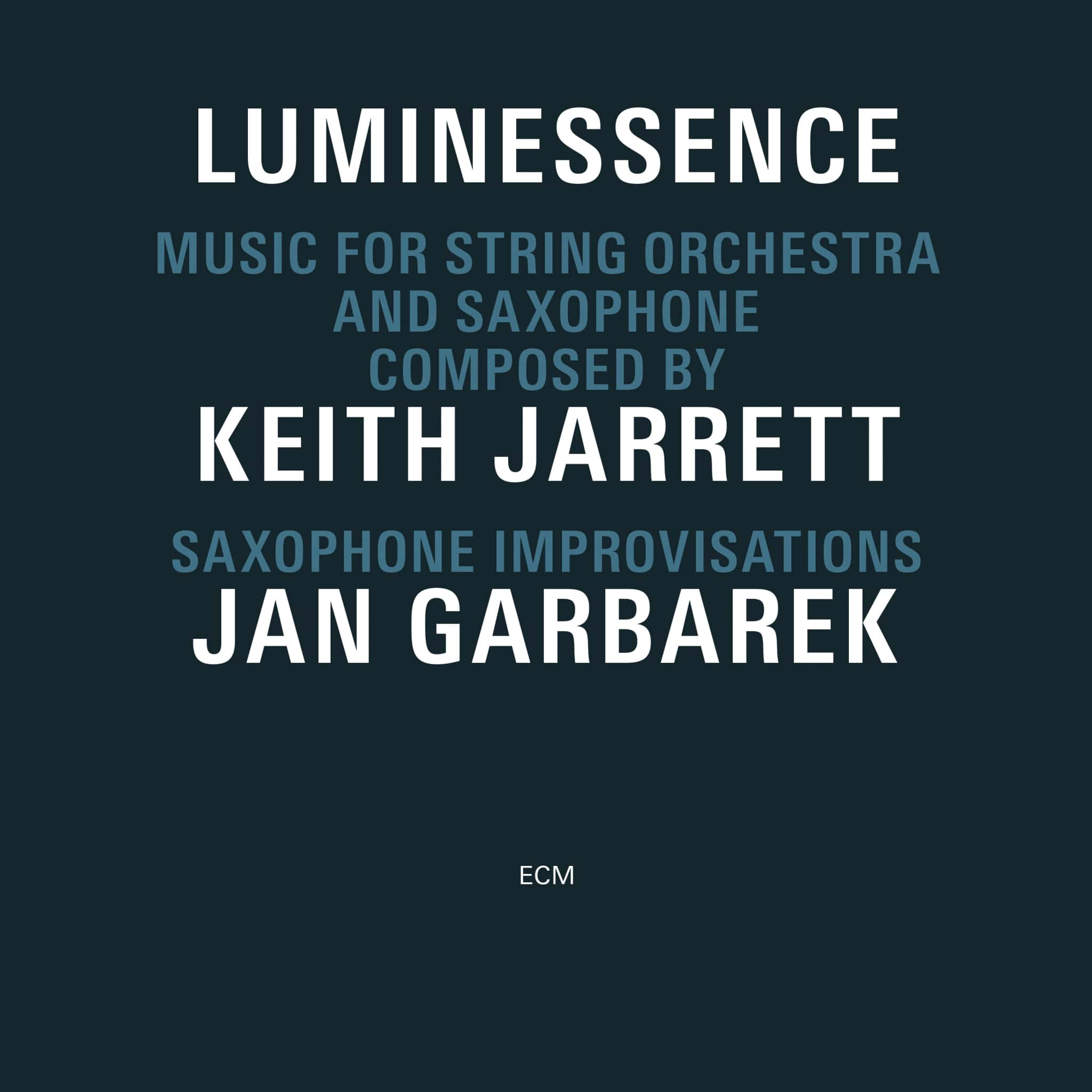Album insights
Viele der sogenannten „Lieder ohne Worte“, welche einen großen Teil von Liszts Transkriptionen ausmachen, umfassen Werke von insgesamt sieben verschiedenen Komponisten. Neben zahlreichen Schubert-Liedern und sechs Chopin-Stücken finden sich auch viele von Liszt selbst transkribierte Lieder, etwa von Alyabiev bis Wielhorsky – insgesamt mehr als 150 Werke. Ähnlich wie bei seinen Operntranskriptionen variieren Stil und Ansatz dieser Klavierwerke stark: von einfachen Übertragungen bis hin zu fantasievollen Bearbeitungen. Ziel war es dabei, die Musik einem größeren Publikum zugänglich zu machen, da zu Liszts Zeit noch keine Liederkonzerte im heutigen Sinne existierten. Liszt integrierte fast immer den originalen Liedtext in die Klaviernoten, um nicht nur das Interesse der Hörer zu wecken, sondern auch Pianisten eine präzise Vorstellung von der gewünschten Interpretation zu ermöglichen. Stets wurde deutlich markiert, welche Stimme ursprünglich gesungen wurde.
Beethovens frühes Meisterwerk „Adelaide“, das einem Klavierkonzertarie ähnelt, folgt mit seinen beiden kontrastierenden Abschnitten dem Gedicht Friedrich Matthisons über unerwiderte Liebe. Liszt schuf hier bedeutende Variationen, blieb dabei aber stets nah am Text Beethovens. In verschiedenen Versionen ergänzte er eine reflektierende Koda und erweiterte das Ende diskret, um eine freiwillige Kadenz zu schaffen. Auch wenn Liszt in seinen Beethoven-Transkriptionen oft vom Original abweicht, bleibt der Bezug zum Text stets erhalten. Die Abfolge der Gedichte widmet sich der Macht und Vorsehung Gottes, dem Flehen, der Reue, dem Tod sowie der Gottesherrlichkeit in der Natur.
In seiner Übertragung von Beethovens Liederzyklus „An die ferne Geliebte“ nimmt Liszt sich nur wenige Freiheiten heraus, lässt beispielsweise wiederholte Melodieteile aus, um die wechselnde Begleitung hervorzuheben. Die Lieder gehen nahtlos ineinander über und spiegeln die Strophen des Gedichts von Aloys Jeitteles wider. Die Lieder von Robert Franz sind außerhalb des deutschsprachigen Raums fast unbekannt, zeichnen sich aber durch aphoristische Einfachheit aus. Viele von Liszt transkribierte Franz-Lieder bleiben eng am Original. Liszts Schumann-Transkriptionen haben Generationen von Pianisten beeindruckt und sind fest im Repertoire verankert.
Anton Rubinsteins Werke boten Liszt nur zwei Lieder zur Transkription, die dennoch ihren Platz behaupten, auch wenn sie im Repertoire weniger bedeutend sind. Liszts Schumann-Transkriptionen konzentrieren sich eher auf weniger bekannte späte Werke als auf das Populäre. Seine sensiblen Bearbeitungen von Clara Schumanns Liedern konnten sich nicht durchsetzen, obwohl sie – trotz Claras Abneigung gegenüber Liszt und seiner Musik – entstanden sind.
Die späte Transkription von Schumanns „Provenzalischem Lied“ interpretiert Uhlands Minnelied auf neue Weise. Reinickes Gedicht „An das Licht der Sonne“ wird durch Schumanns Vertonung von Burns‘ Gedicht bereichert. Trotz großer Originaltreue verwandelte Liszt einige Schumann-Lieder in feinfühlige Klavierstücke. „Widmung“, ein Geschenk Schumanns an Clara, zeigt Liszts Respekt vor Schumanns Musik; die Erweiterung dieser populären Lieder in Liszts Transkription ist ein schöner Tribut an die Meisterwerke der Komposition.