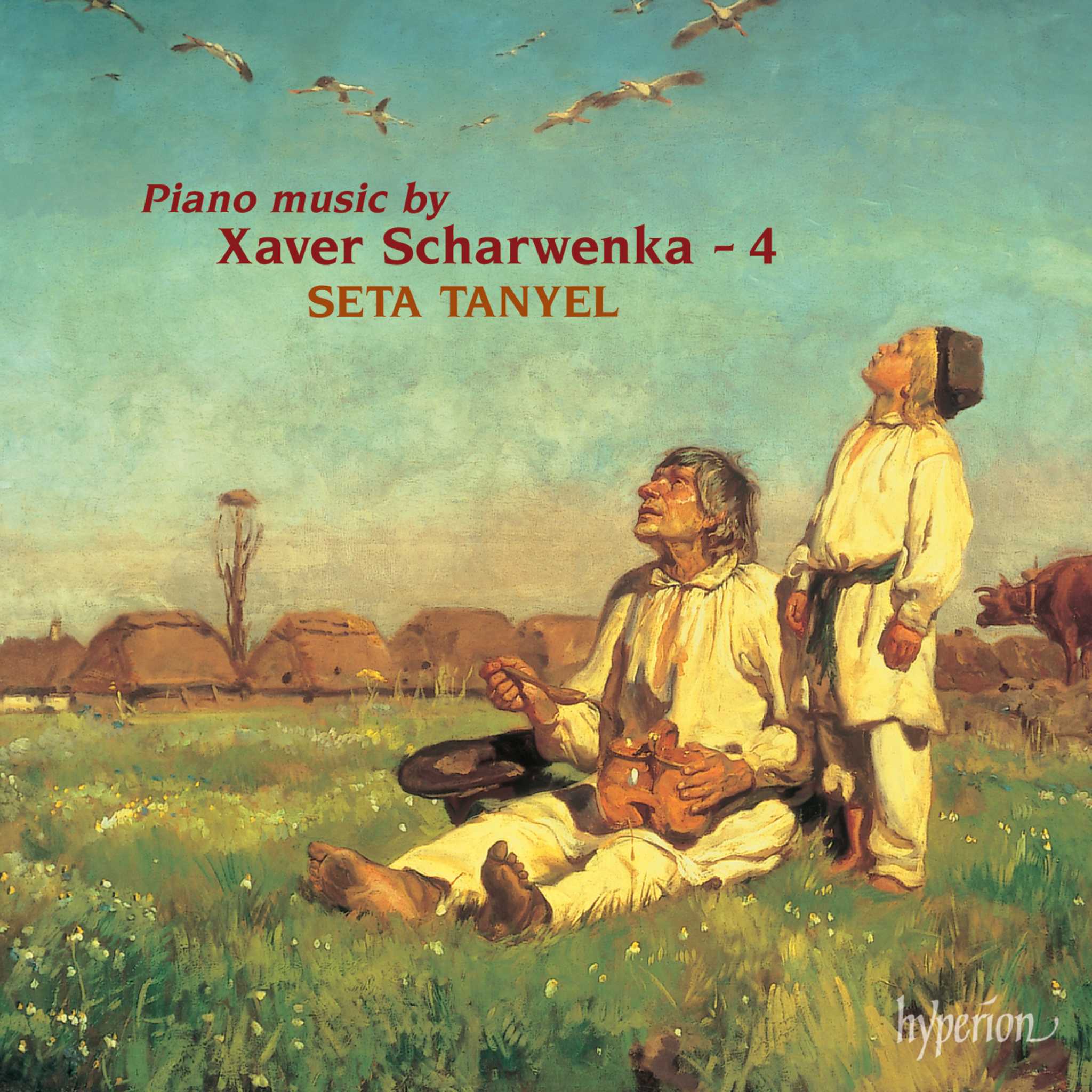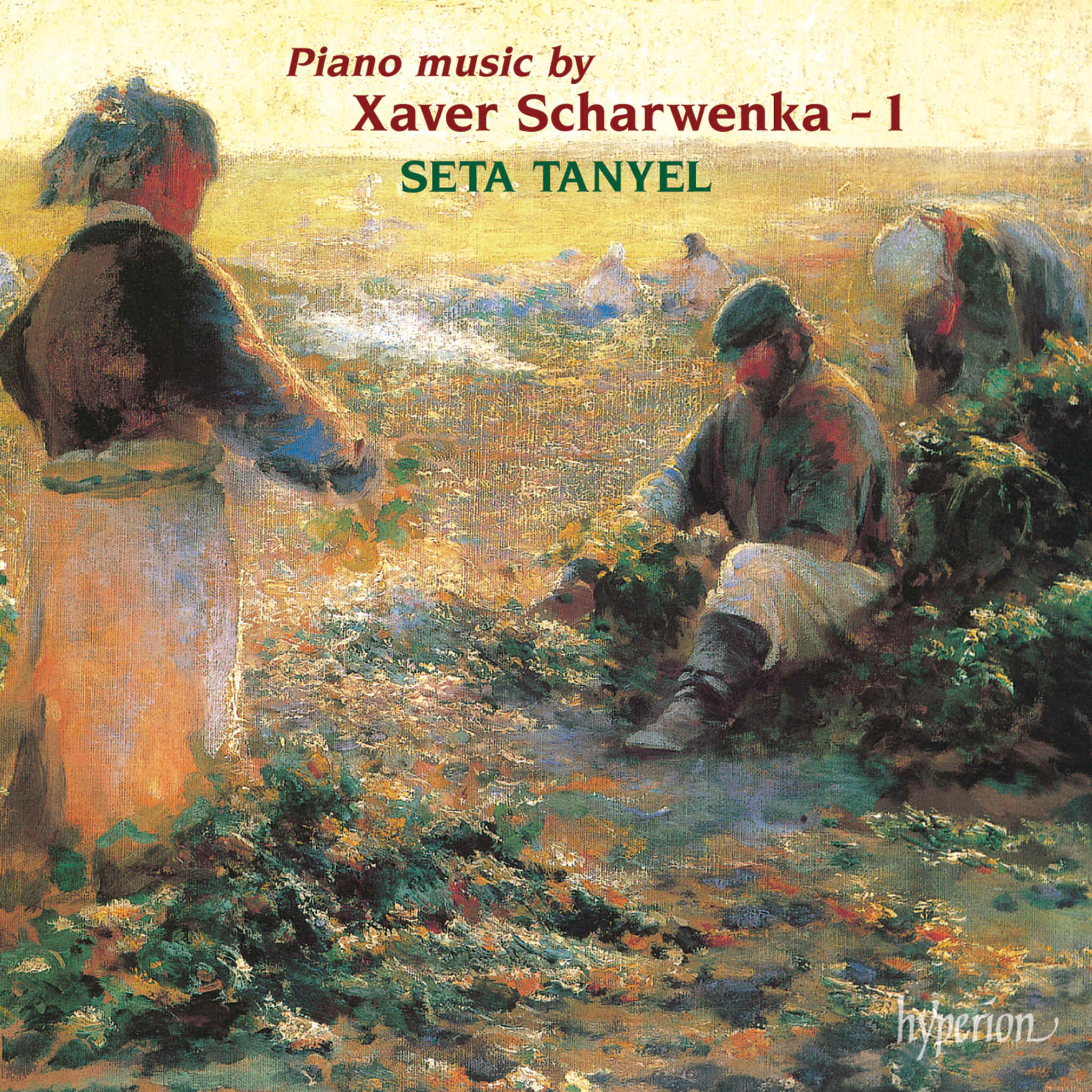Während des 19. Jahrhunderts wurde die Musik von Komponisten wie Moszkowski, die mit Salonmusik assoziiert wurden, häufig geringschätzig bewertet. Diese Abwertung wandelt sich allerdings in der Gegenwart, da im Zuge des neuen Interesses an der Romantik Moszkowskis Klavierkompositionen als spannende Entdeckungen angesehen werden. Es ist erwähnenswert, dass Paderewski Moszkowski nach Chopin als einen der bedeutendsten Komponisten für Klavier betrachtete.
Moritz Moszkowski kam 1854 in einer wohlhabenden polnisch-jüdischen Familie in Breslau zur Welt. Seine ersten musikalischen Unterweisungen erhielt er zu Hause, bevor seine Familie 1865 nach Dresden übersiedelte, wo er am Konservatorium studierte. Anschließend vervollständigte er seine Ausbildung in Berlin bei Lehrern wie Eduard Franck und Friedrich Kiel. 1873 debütierte er als Pianist in Berlin. Moszkowski unternahm Konzertreisen, komponierte und gewann die Anerkennung von Franz Liszt.
In den darauffolgenden Jahren etablierte er sich als angesehener Pianist, Komponist und Dirigent. Seine Übersiedlung nach Paris 1897 markierte den Höhepunkt seiner Karriere. Moszkowski, der auch als talentierter Geiger galt, hinterließ bei vielen Musikern seiner Zeit einen nachhaltigen Eindruck. Nach 1908 ließ sein Ruhm aufgrund von Gesundheitsproblemen und persönlichen Schicksalsschlägen nach. Später verarmte Moszkowski durch Investitionen, die der Erste Weltkrieg wertlos machte, und starb 1925 in Paris.
Moszkowski war für seine brillante Klaviermusik bekannt, die einen charakteristischen Stil aufweist. Seine kreativen Entwicklungen spiegeln sich in Werken von den "Fantaisie Impromptu" der 1870er Jahre bis zur "Grande Valse de Concert" von 1912 wider. Kompositionen wie Opus 24 und Opus 42 demonstrieren Moszkowskis technische Fähigkeiten und seine raffinierte Salonmusik. Eine beachtenswerte Paraphrase von Wagners Tristan und Isolde, veröffentlicht 1914, bezeugt seine anerkannte Meisterschaft.
Martin Eastick © 1996