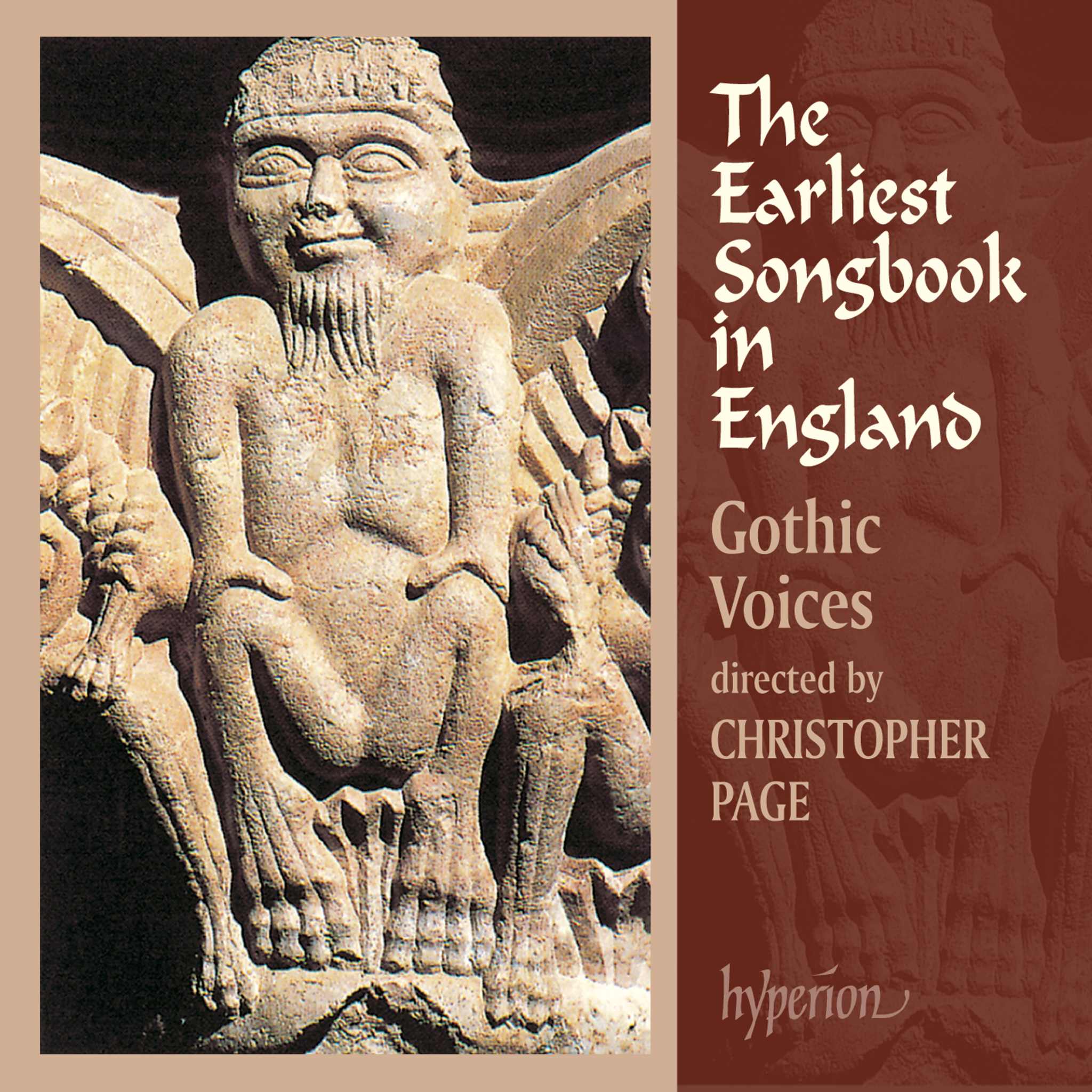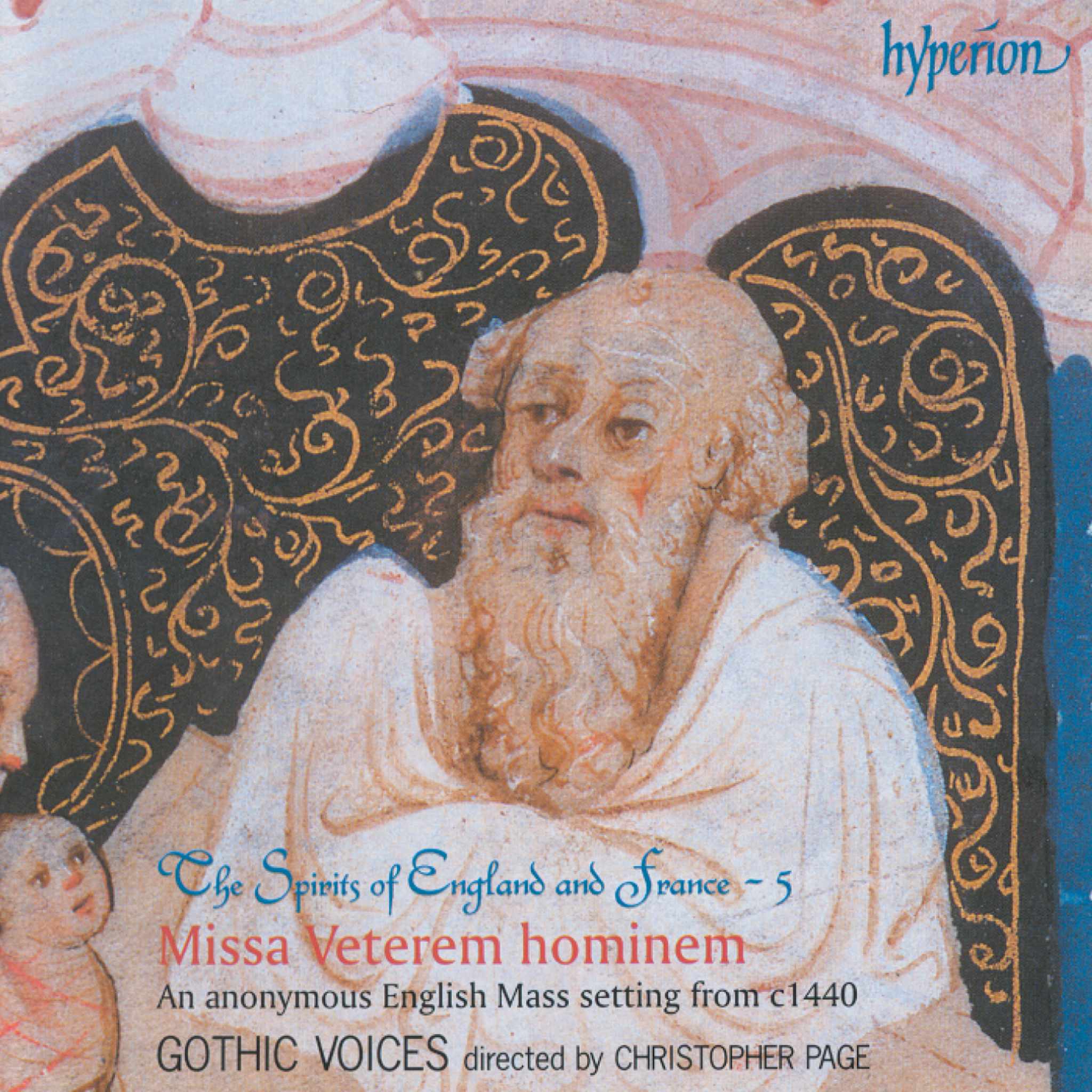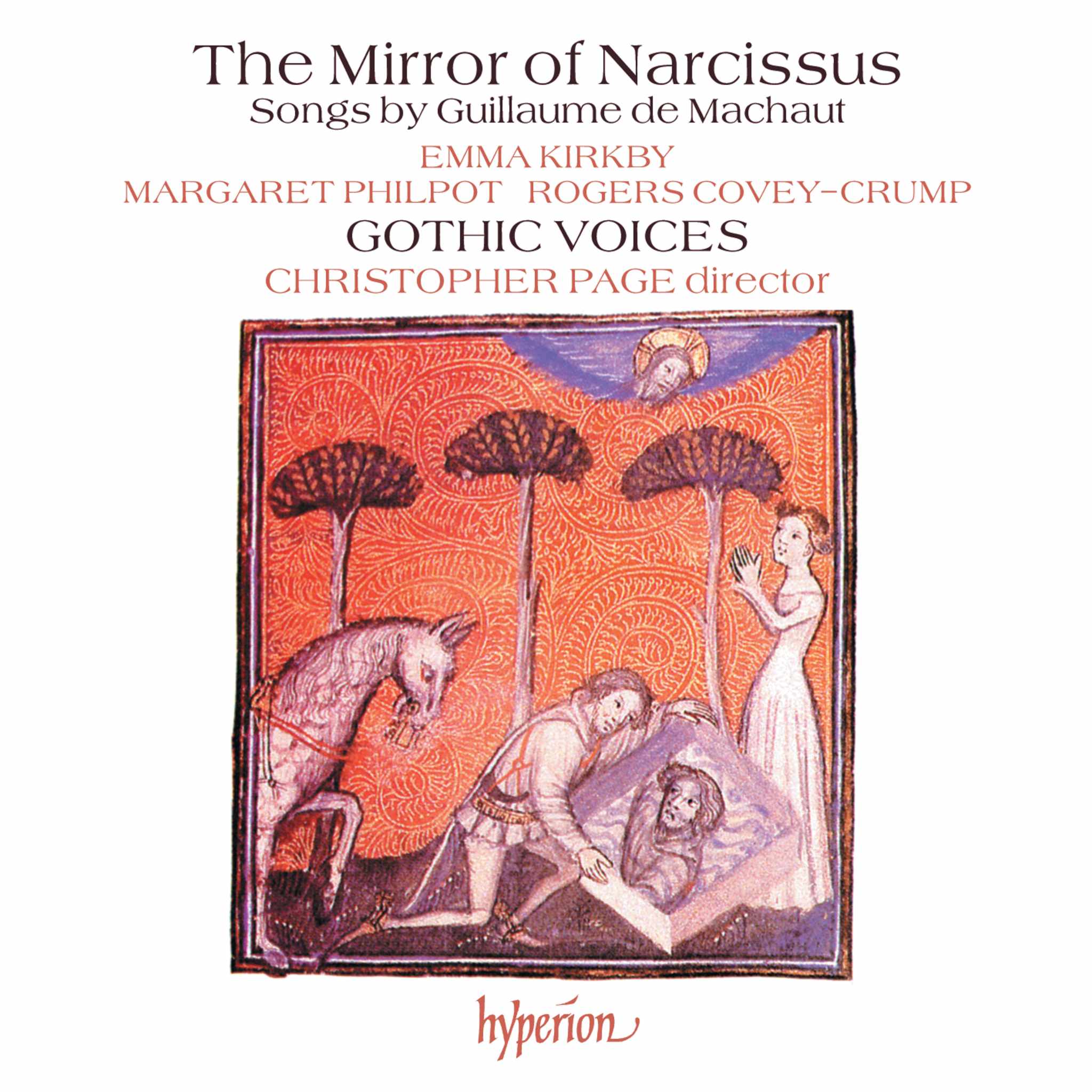Album insights
Das dritte Album mit Liedern von Liszt umfasst einen Zeitraum von fünf Jahrzehnten und vereint ernste Miniaturformen mit groß angelegten Werken. Es verdeutlicht Liszts künstlerische Bandbreite, da er Gedichte verschiedener Autoren und in unterschiedlichen Sprachen vertonte. Oft bearbeitete er seine eigenen Stücke erneut und nutzte das Lied als Experimentierfeld für neuartige Harmonik und Tonalität. Die Werke wandten sich nicht an sein gewöhnliches Publikum, sondern boten Liszt die Möglichkeit, seine kompositorischen Phasen zu überschreiten und neue Wege zu gehen. Ein Paradebeispiel hierfür ist der Liederzyklus Tre sonetti di Petrarca.
Während ihrer Italienreise beschäftigten sich Liszt und Marie d'Agoult intensiv mit den Werken von Dante und Petrarca. Zwischen 1842 und 1846 veröffentlichte Liszt die erste Fassung der Tre sonetti di Petrarca. Fast zwei Jahrzehnte arbeitete er an einer zweiten Version für Mezzosopran oder Bariton. Den Zyklus eröffnete er mit „Benedetto sia ’l giorno“, einer Huldigung an Petrarcas Muse Laura. Der Zyklus zählt zu den eindrucksvollsten literarischen Darstellungen der Liebe.
Das Gedicht „Pace non trovo“ setzt sich auf paradoxe Weise mit den Widersprüchen der Liebe auseinander. Liszt schuf hierzu zwei Fassungen, in denen er eindrucksvoll mit Dissonanzen und Akkordverbindungen arbeitete. Beide Bearbeitungen enden offen und unterstreichen so die Ambivalenz des Liebesgefühls.
Heine würdigte Liszt mit vielschichtigen Komplimenten für dessen temperamentvolle Seele und musikalischen Ausdruck. Trotz des Zerbrechens ihrer Freundschaft entstanden einige der bedeutendsten Heine-Vertonungen des Jahrhunderts, darunter auch das Lied „Anfangs wollt' ich fast verzagen“. Dieses Werk regte Liszt dazu an, über Hoffnung und Vernunft nachzudenken.
Heines „Ein Fichtenbaum steht einsam“ setzte Liszt musikalisch als kreisende Bewegung mit zahlreichen Halbtönen und Echoeffekten um. Durch seine harmonische Gestaltung und die Klangfarben entsteht eine düstere, melancholische Grundstimmung.
Zu den Werken, die von Liszts Freund Franz Carl Graf Coronini inspiriert wurden, zählt Die Fischerstochter. Dieses Lied erzählt von einer tragischen Liebe und einem verlorenen Leben. Die Komposition verbindet innovative lyrische und dramatische Elemente; das Ende bleibt, typisch für Liszt, unentschieden und hebt die Vergeblichkeit der Liebe hervor.
Mit dem Gedicht „Wer nie sein Brot mit Tränen ass“ setzte sich Liszt ebenfalls auseinander. Hier demonstriert er seine Virtuosität und erzeugt eine Atmosphäre tiefster Verzweiflung und Emotionalität. Durch Sprünge und Akkorde wird die Erschütterung des Harfners eindringlich erlebbar.
Victor Hugos Dichtung inspirierte Liszt zu einigen seiner populärsten Lieder. In La tombe et la rose begegnen sich Grab und Rose in einem Dialog, der die Kraft der Verwandlung thematisiert. Viele von Liszts Liedern schließen mit offenen Enden, wodurch das Triumphieren des Geistes über den Tod betont wird.
Ein weiteres auf Hugo basierendes Werk ist Gastibelza, das eine spanische Geschichte von unerfüllter Liebe und Verzweiflung erzählt. Liszt verwendet hier eine farbenreiche Harmonik und vielschichtige Texturen, die den lebhaften Charakter der Erzählung widerspiegeln.
In späten Liedern wie Go not, happy day spiegeln sich Liszts persönliche Melancholie und Depression wider. Diese Stücke sind von Innerlichkeit geprägt und münden oft in einen offenen Schluss, der die Unsicherheit des Lebens ausdrückt. Liszt wagte in seinen Kompositionen stets emotionale Grenzgänge und setzte radikale musikalische Neuerungen um.