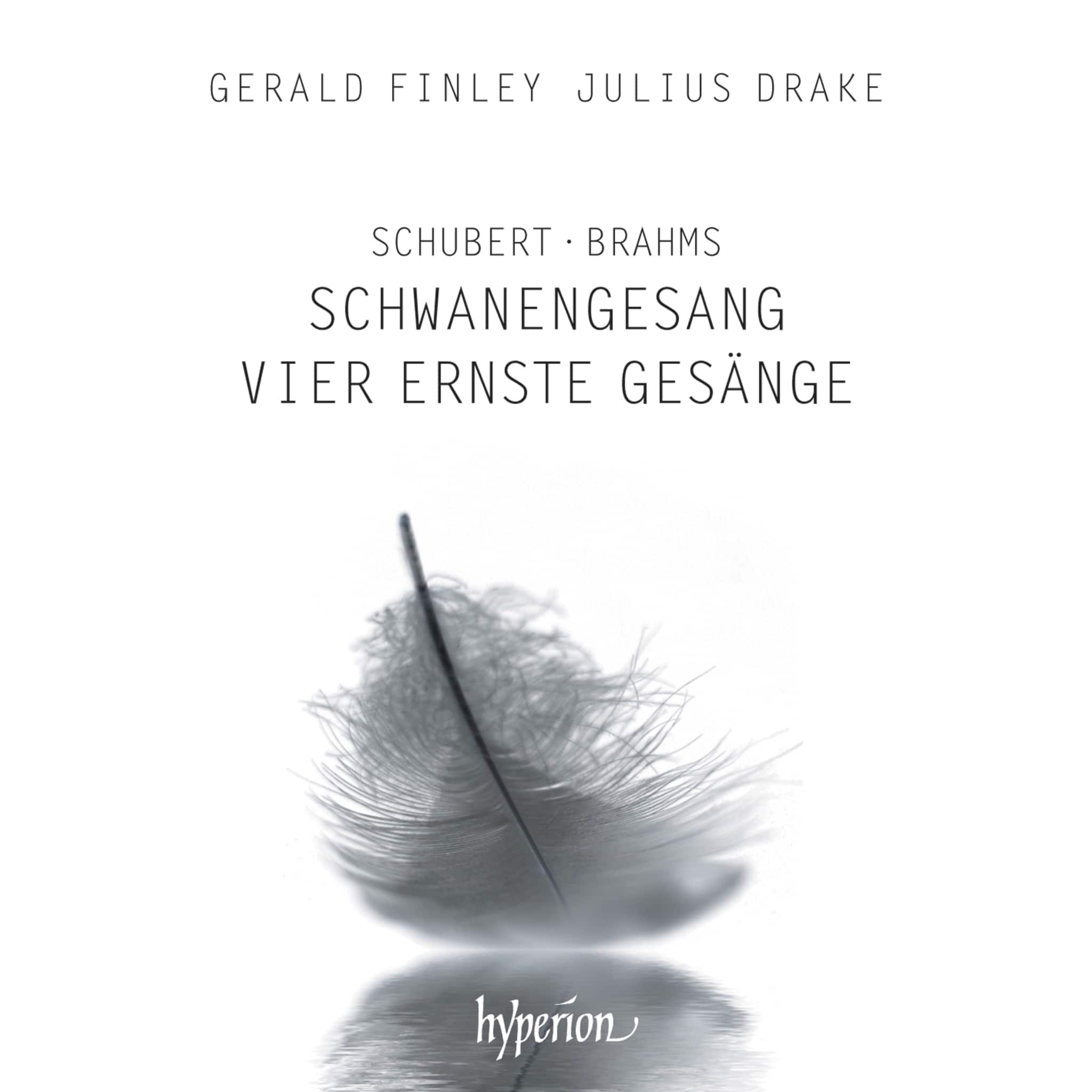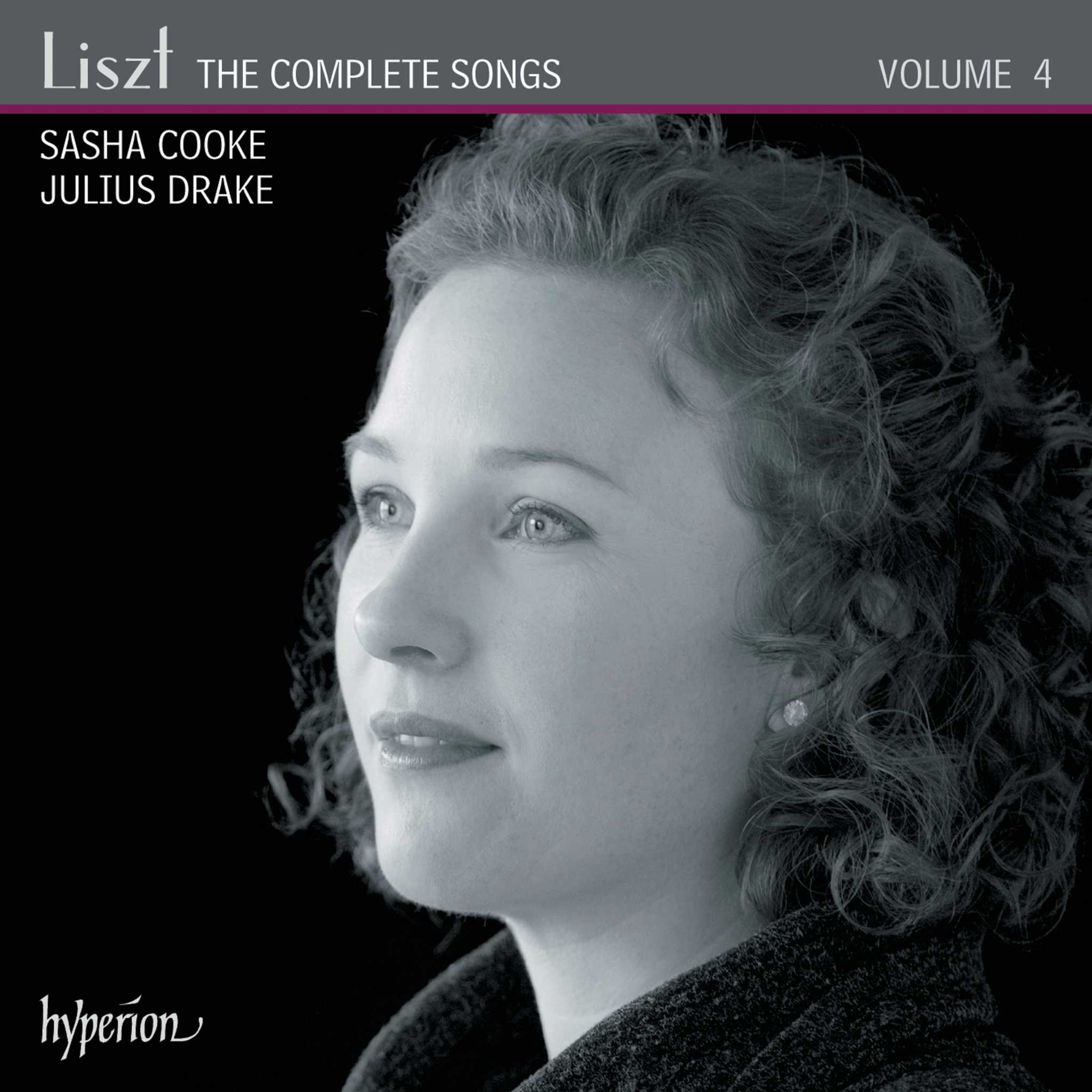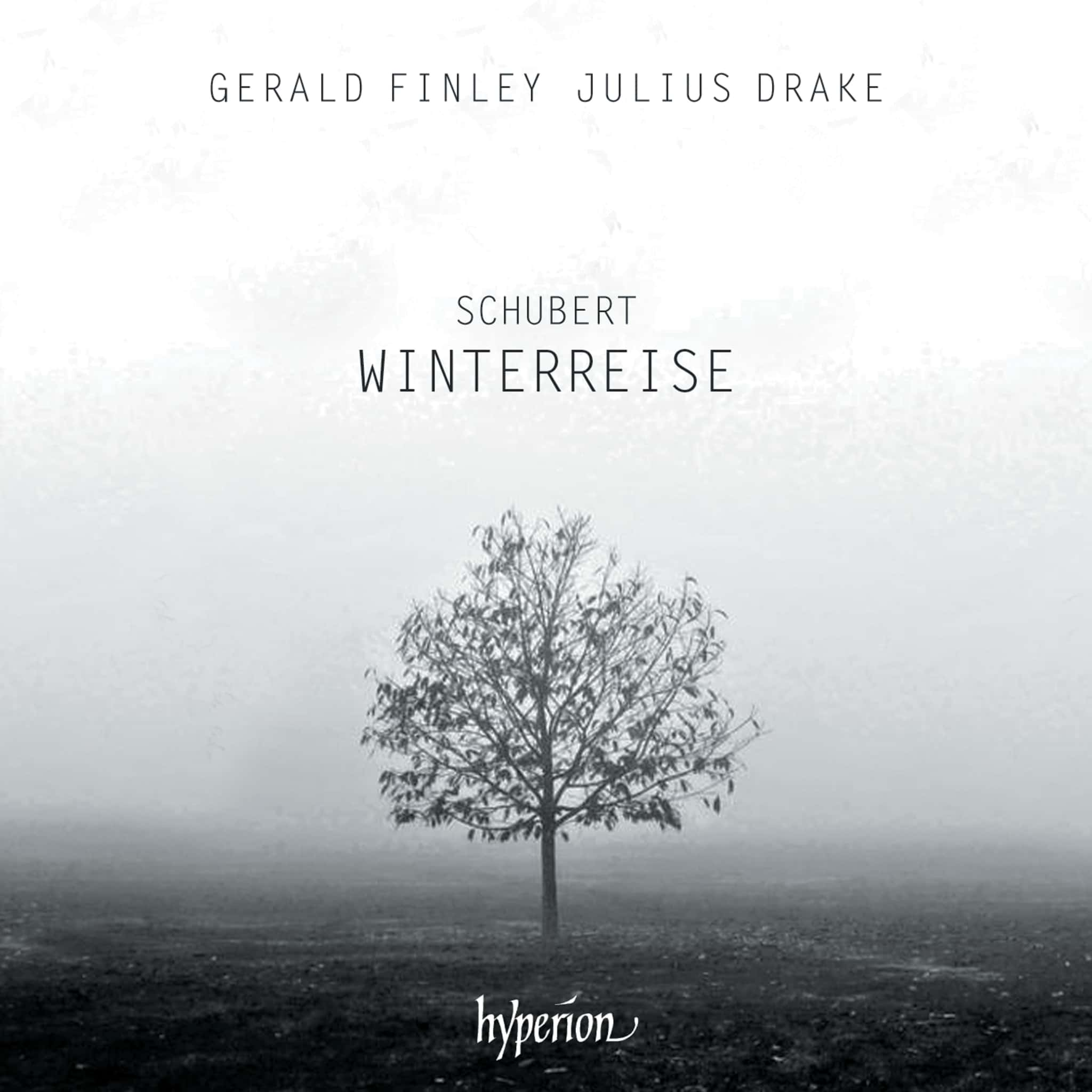Album insights
Goethes bekannte Metapher vom Streichquartett als „Gespräch zwischen vier vernünftigen Leuten“ spiegelt treffend die Entwicklung des Genres um 1800 wider, insbesondere durch die Werke von Haydn, Mozart und Beethoven. Schubert, der bereits mit 13 Jahren sein erstes Quartett schrieb, komponierte im Anschluss zahlreiche weitere Stücke – oft für Mitschüler oder das eigene Familienensemble bestimmt.
Als Schubert das B-Dur-Quartett D112 verfasste, bewegte er sich zwischen seiner Tätigkeit als Lehrer und seiner Leidenschaft fürs Komponieren. Trotz seiner Verpflichtungen entstand das Werk in bemerkenswert kurzer Zeit: Laut eigener Notiz schrieb er den ersten Satz innerhalb von viereinhalb Stunden am 6. September, während er für das Andante sostenuto in g-Moll fünf Tage benötigte. Schon in diesem frühen Quartett findet man orchestrale Strukturen, eine weiche, chromatische Thematik und einen durchgehend lyrischen Ton. Die Musik zeichnet sich durch jugendliche Begeisterung und Pastellfarben aus, wobei nervöse Triolen und kräftige Forte-Akkorde für Kontraste sorgen.
Auffällig ist Schuberts Umgang mit der Form: Die Exposition ist in weitläufige tonale Blöcke gegliedert, wobei das erste Thema frei zwischen den Instrumenten wandert. Im Menuetto, das eher an einen ländlichen Schuhplattler als an einen höfischen Tanz erinnert, begegnet man einem spannenden Wechselspiel zwischen den Stimmen. Im Trio verschmelzen sanfte Melodien der Violinen mit zartem Pizzicato der Bratsche und des Cellos. Ein Höhepunkt des Quartetts ist das Presto-Finale, das mit staccatoartigen Achteln der ersten Geige und bewegten Figuren der tiefen Stimmen ein scherzoartiges Temperament entfaltet.
Ein Jahrzehnt später schuf Schubert mit dem G-Dur-Quartett D887 ein Werk, das neben seinem Streichquintett als besonders ambitioniert gilt. Diese Musik verlangt den Interpreten technisch und musikalisch viel ab und fasziniert durch ihre Vielschichtigkeit. Schuberts Tonsprache bleibt trotz hörbarer Einflüsse eigenständig und unverkennbar. Im G-Dur-Quartett zeigt sich ein beethovenscher Ansatz im Kopfsatz, dessen Intensität und Klangfülle von kontrastreichen Passagen und einer beruhigenden Reprise durchbrochen werden.
Jeder Satz belegt Schuberts besondere kompositorische Handschrift sowie sein Talent für musikalischen Ausdruck. Das Wechselspiel von lyrischen, tänzerischen und dramatischen Elementen macht das Quartett zu einem Meisterwerk, das die Vielseitigkeit von Schuberts musikalischer Persönlichkeit widerspiegelt.