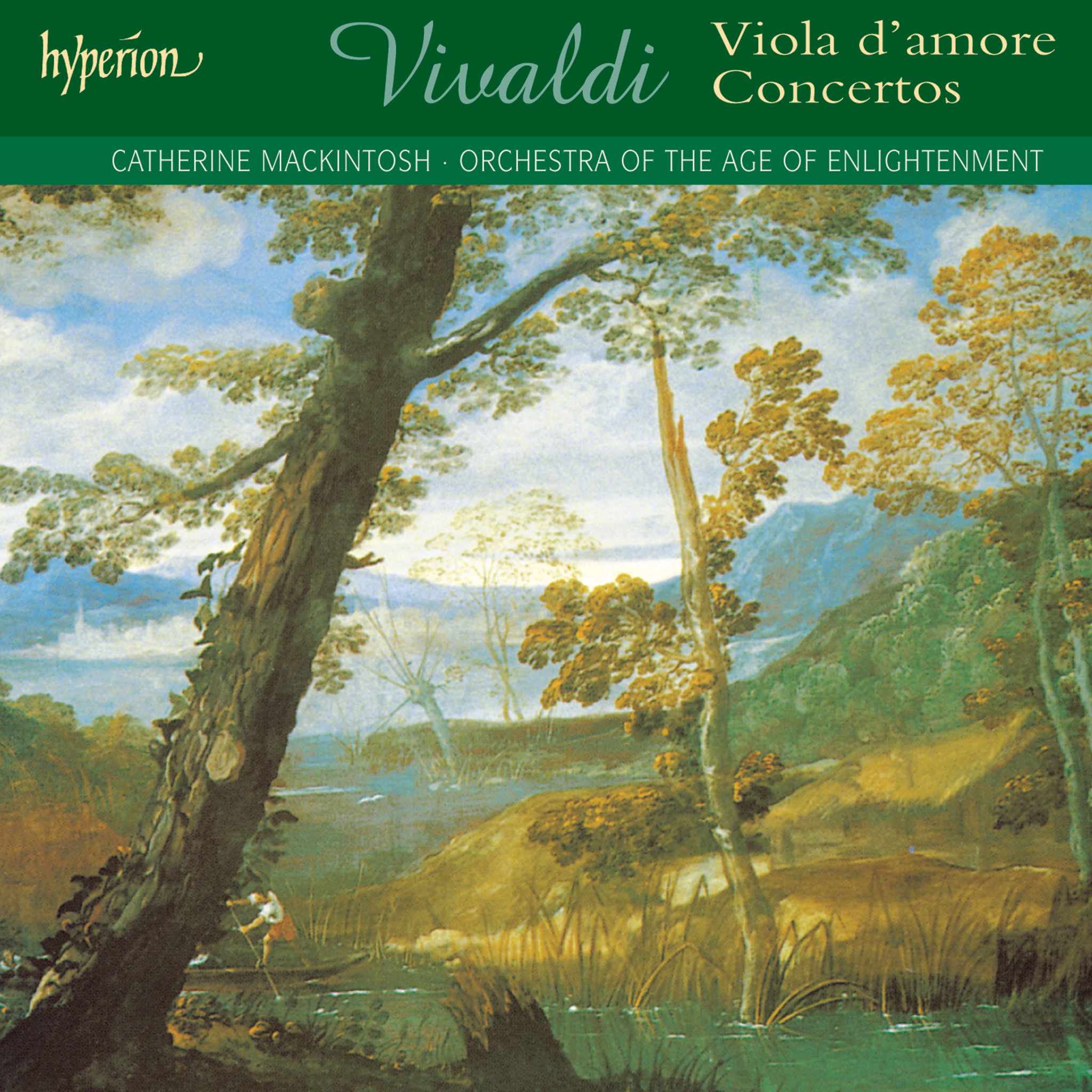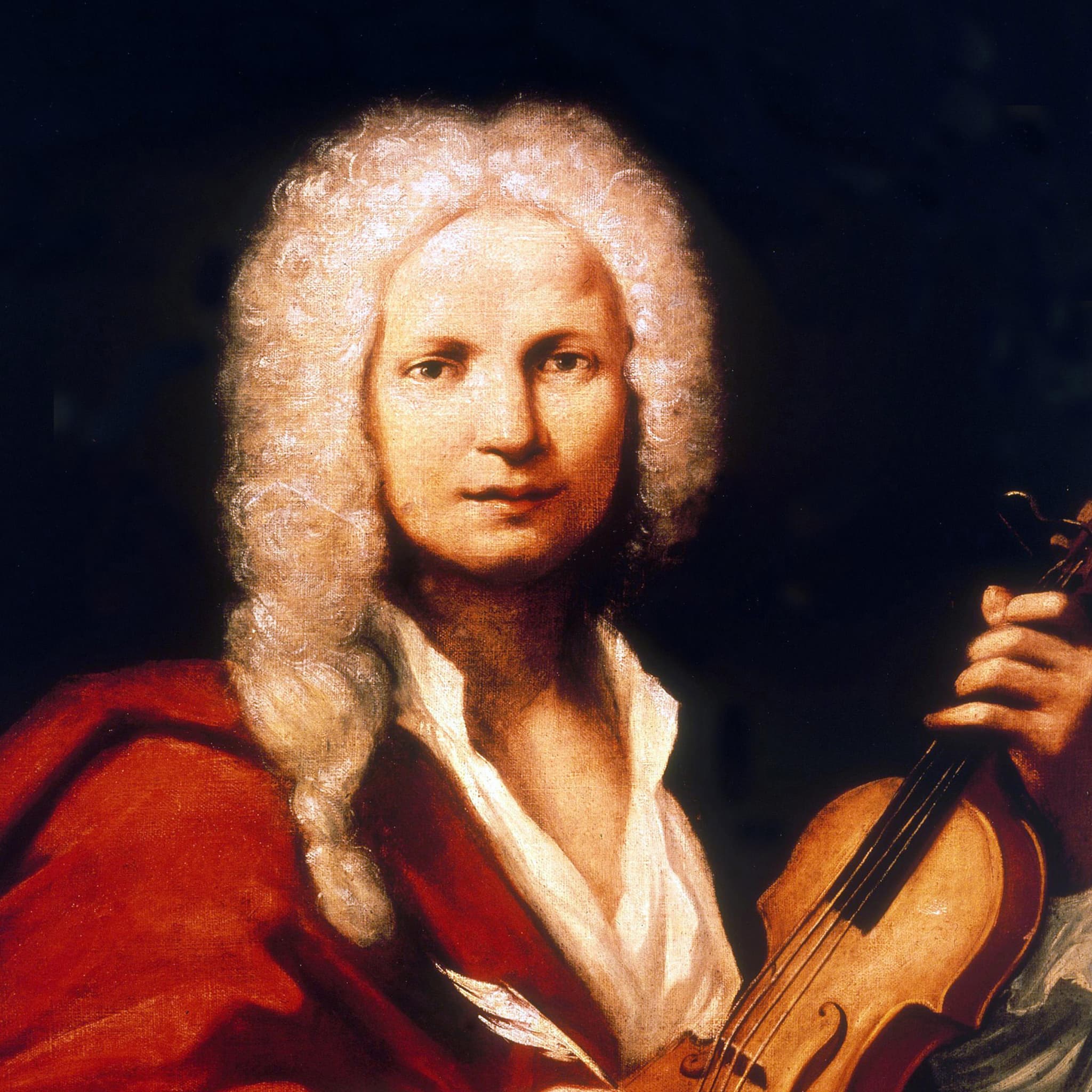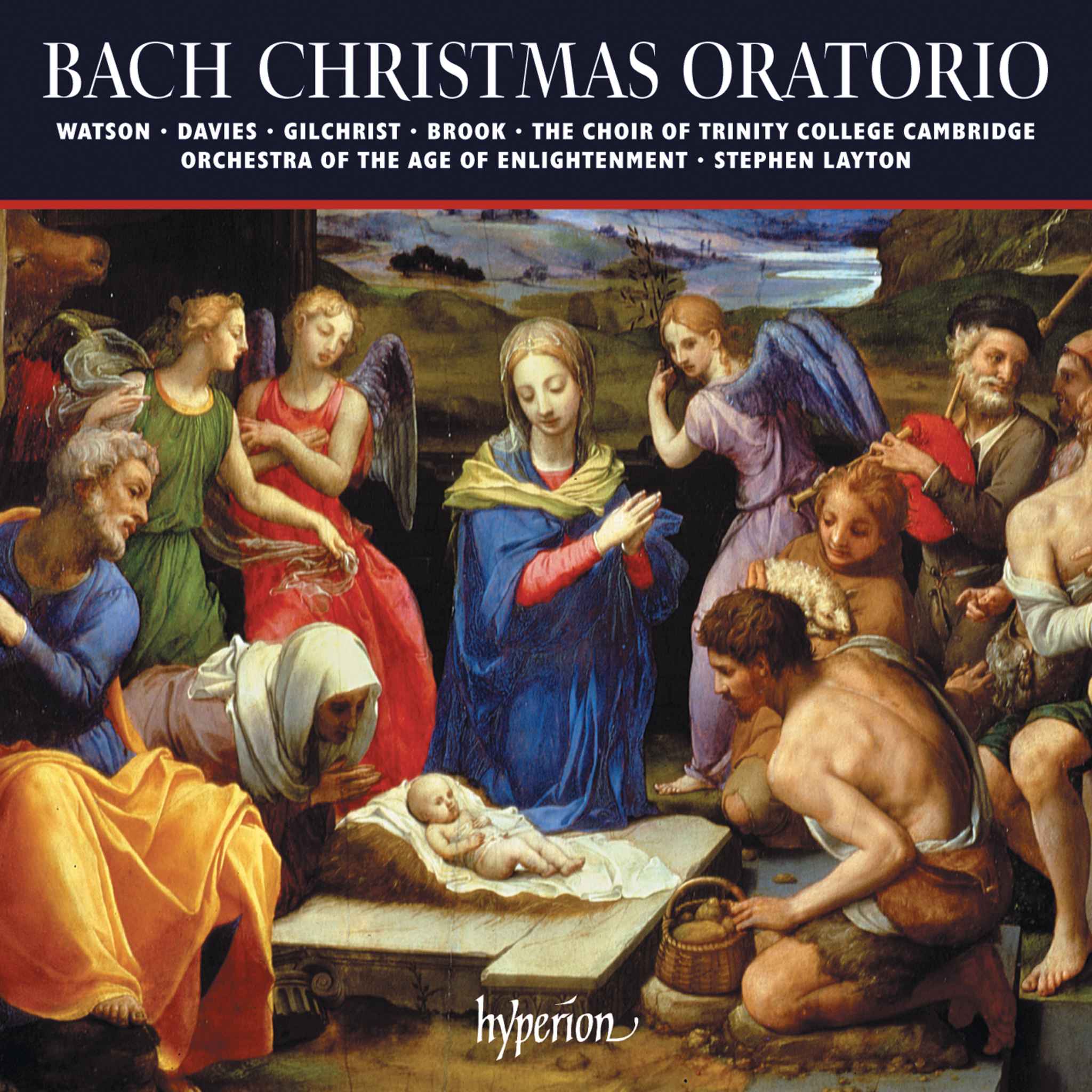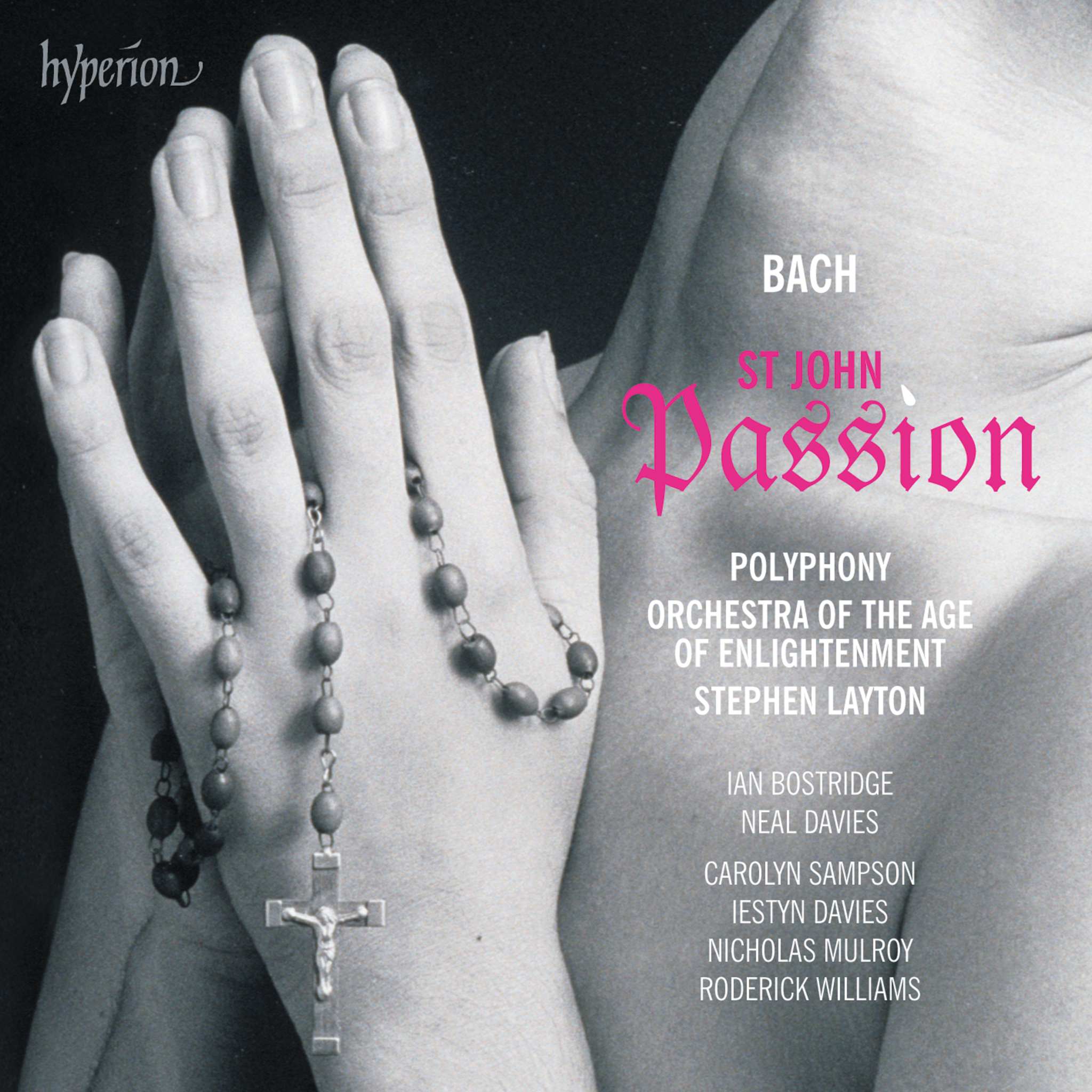Album insights
Antonín Dvořák war zunächst nicht gewillt, ein Cellokonzert zu schreiben, da er das Instrument für Solowerke als zu dumpf und wenig geeignet hielt. Vielmehr bevorzugte er Konzerte für Klavier oder Violine. Dennoch überredete ihn der beharrliche Cellist Hanuš Wihan schließlich, sich dem Genre zu widmen. Weitere entscheidende Anregungen kamen aus unerwarteten Quellen: Ein Besuch an den Niagarafällen während seines Aufenthalts in Amerika, der Einfluss des irisch-amerikanischen Komponisten Victor Herbert, der selbst Cellokonzerte aufführte, sowie die schwere Erkrankung seiner Schwägerin Josefina Čermáková, die Dvořáks emotionale Verfassung prägte.
Die Arbeit am Cellokonzert begann Dvořák in New York im Herbst 1894 und stellte es im Februar 1895 fertig. Ursprünglich plante er, eine Sinfonie zu komponieren, doch die Eindrücke von Victors Herberts Cellospiel sowie die Inspiration durch die amerikanische Landschaft führten zu einem Wandel. Die Nachricht von Josefinas Krankheit bewegte ihn, und Fragmente von deren Lieblingslied fanden Eingang in den zweiten Satz; nach ihrem Tod ergänzte Dvořák das Finale um einen weiteren Bezug auf das Lied.
Während der Kompositionsphase erhielt Dvořák bei technischen Passagen Unterstützung von Hanuš Wihan, lehnte jedoch dessen Wunsch nach zusätzlichen Kadenzen ab, da er auf seiner ursprünglichen Fassung bestand. Die Uraufführung fand im März 1896 in London statt, allerdings spielte nicht Wihan, sondern der englische Cellist Leo Stern, da Dvořák keine Änderungen an seinem Werk zulassen wollte. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wurde das Konzert auch mit Wihan in Budapest aufgeführt.
Das Cellokonzert in h-Moll zeichnet sich durch seine emotionale Tiefe und musikalische Kraft aus. Von einer düsteren Einleitung über einen bewegenden zweiten Satz bis zu einem triumphalen Abschluss entfaltet sich eine mitreißende musikalische Reise. Die abschließende Coda, die Josefinas Andenken gewidmet ist, verleiht dem Werk eine zusätzliche Dimension, die der Uraufführung noch fehlte.
Unterschiedliche Fassungen des Konzerts dokumentieren Dvořáks Suche nach seiner künstlerischen Stimme innerhalb des Genres. Obwohl das Werk anfangs nicht als eigenständiger Meilenstein galt, enthält es viele originelle Elemente, die Dvořáks schöpferisches Talent belegen. Diverse Editionen erlauben verschiedene Lesarten, doch sie alle unterstreichen die bemerkenswerte Vielseitigkeit und Meisterschaft des Komponisten.