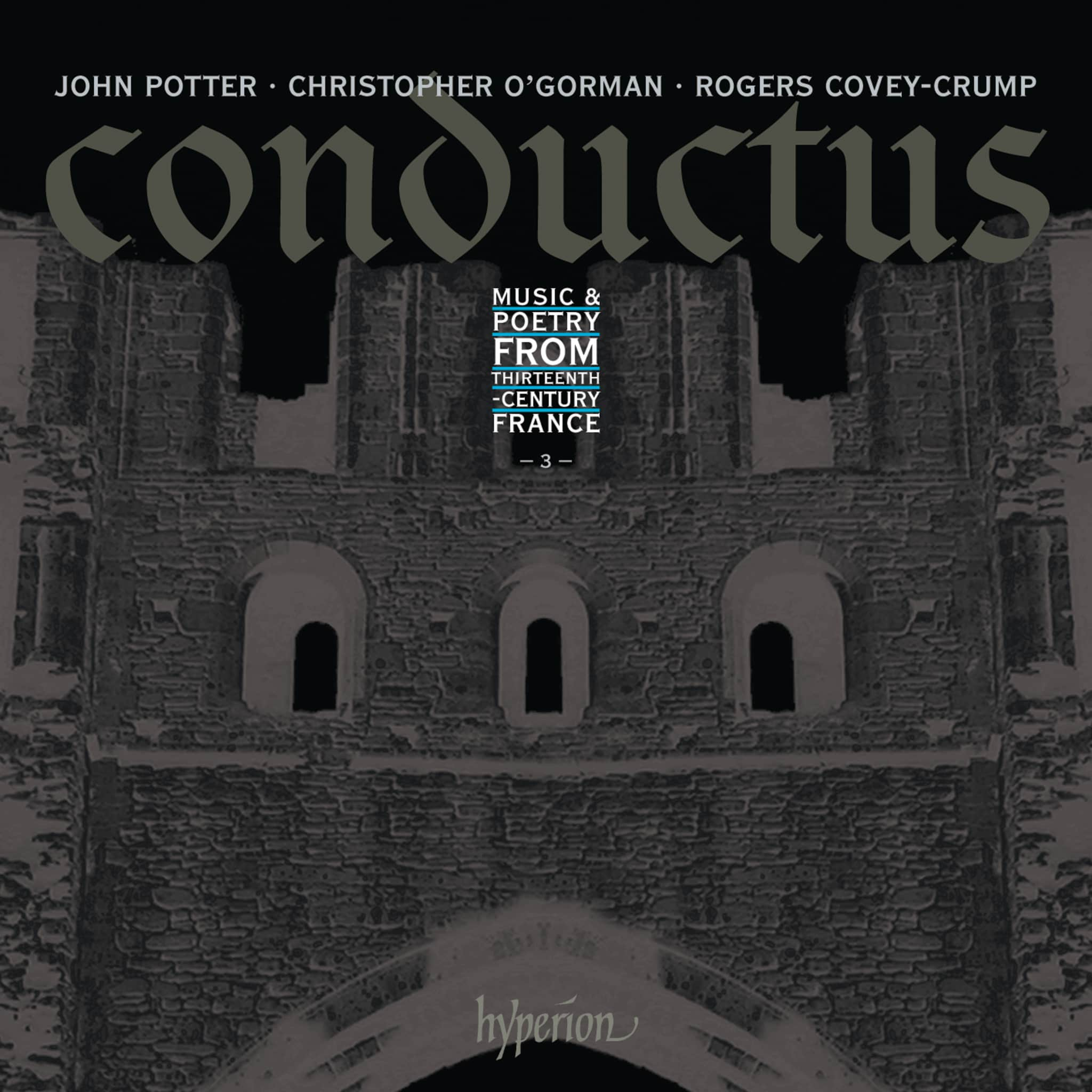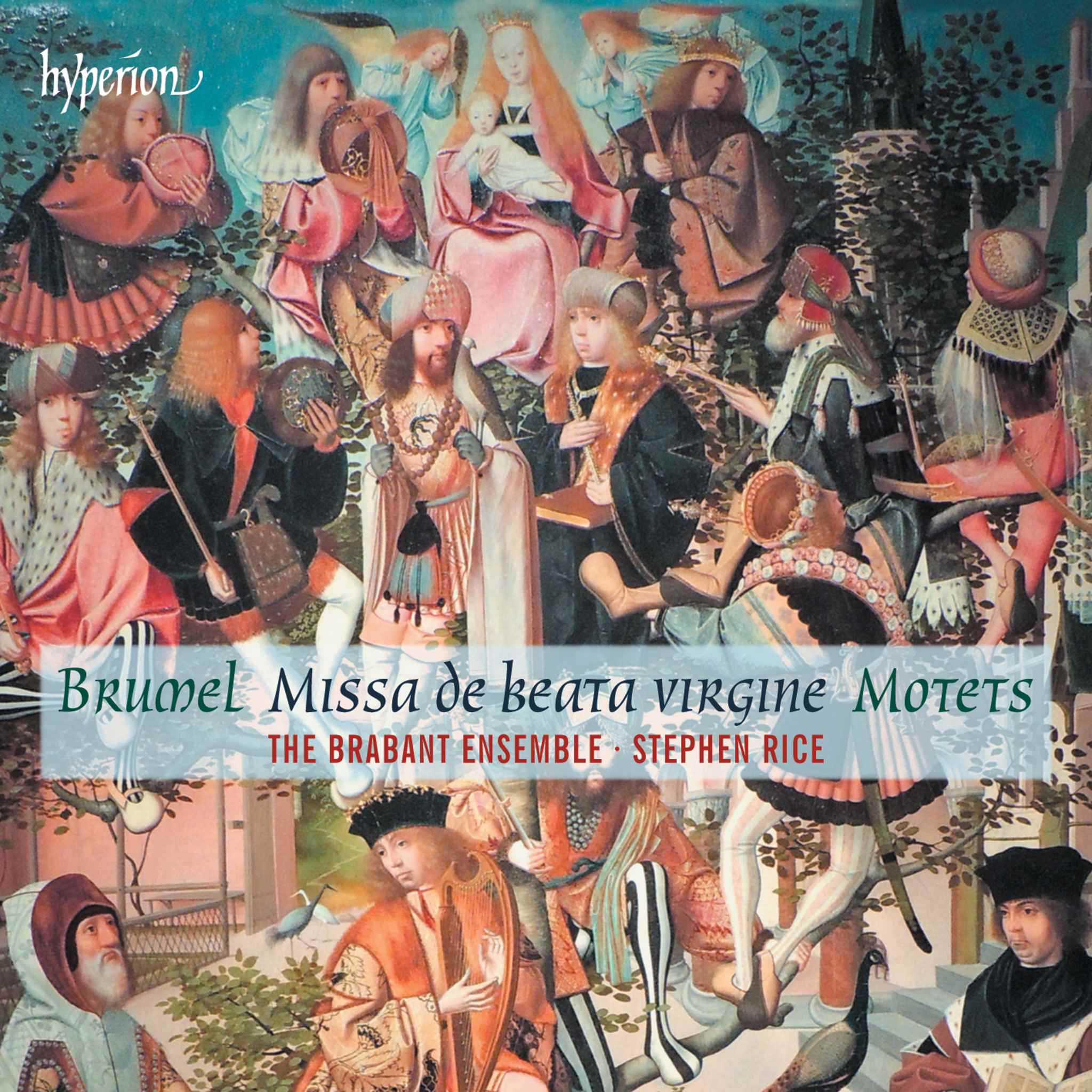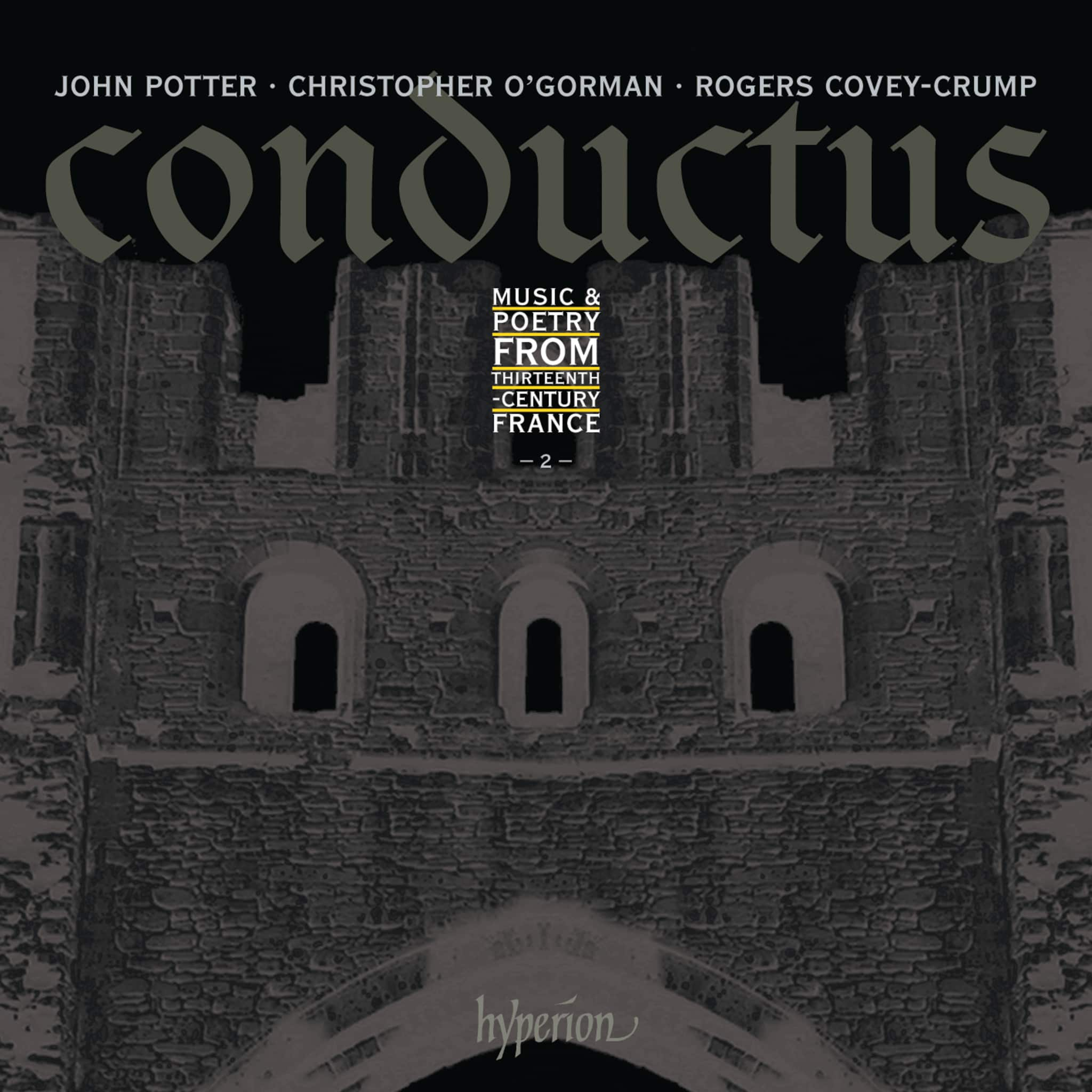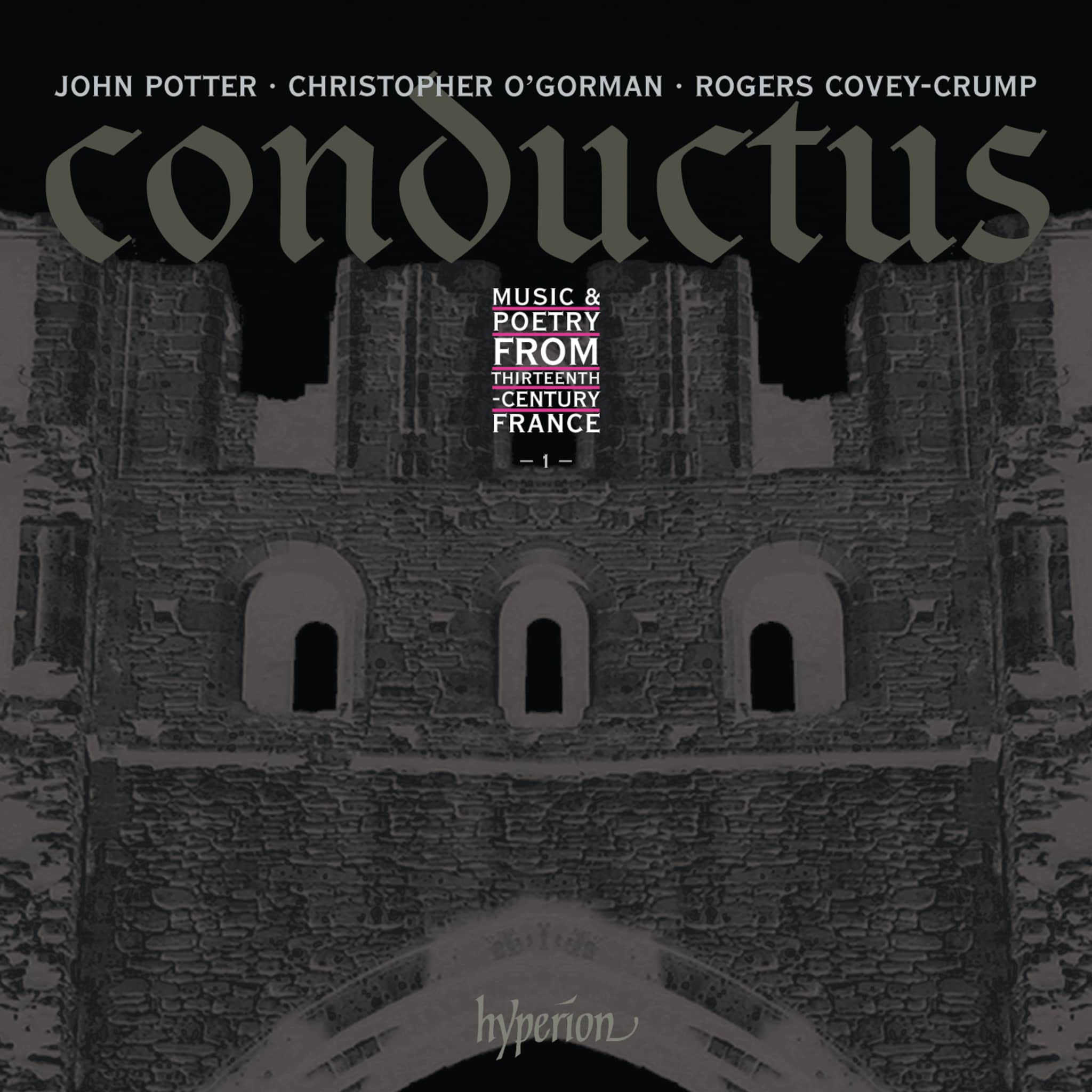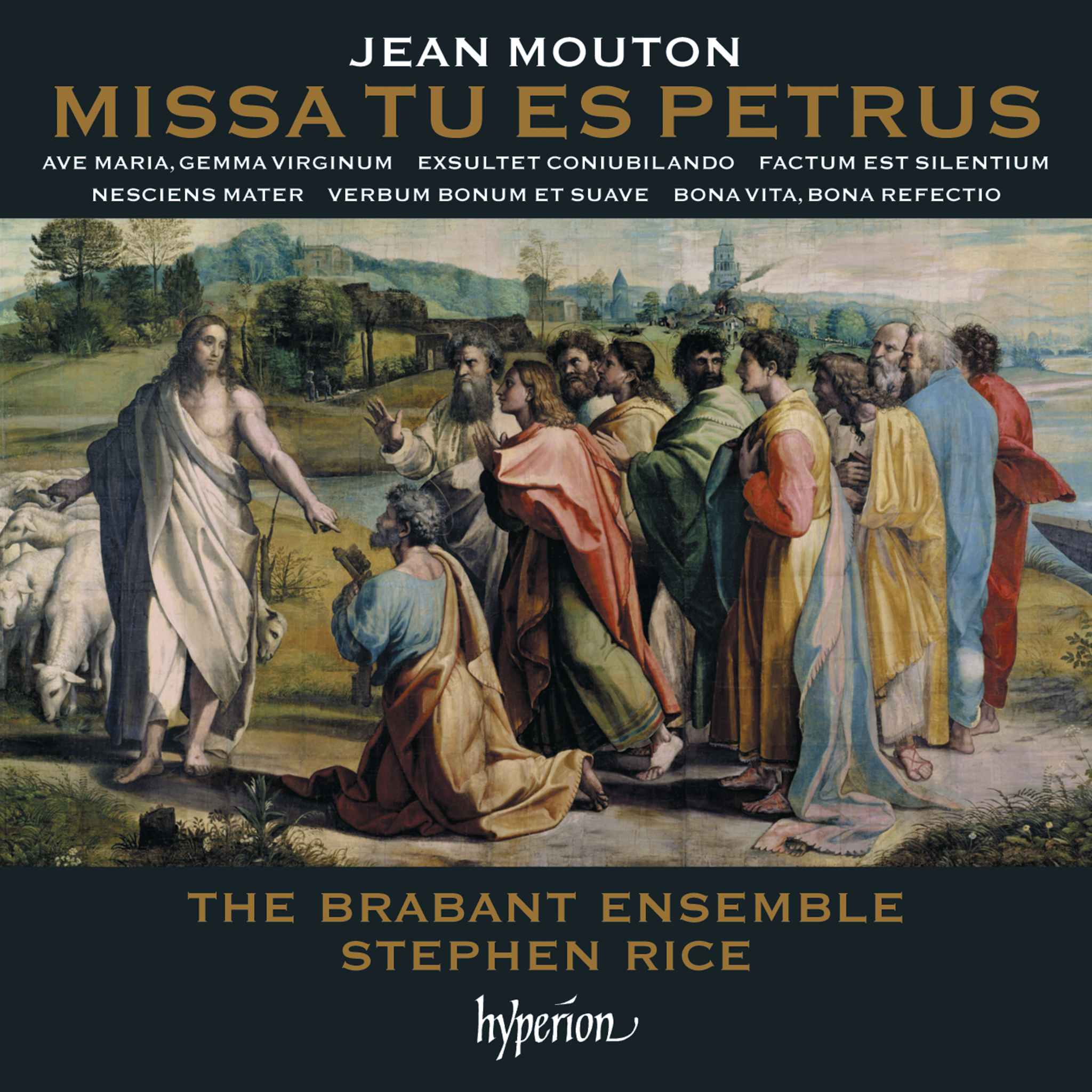Antoine de Févin, der als Sohn eines Ratsherrn vermutlich in Arras geboren wurde, diente als Sänger und Komponist in der königlichen Kapelle von Ludwig XII. Um 1500 zählte er zu den begabtesten französischen Komponisten sakraler Musik. Seine Werke erfreuten sich europaweit großer Beliebtheit, sind jedoch in der heutigen Zeit weitgehend in Vergessenheit geraten.
Févin schuf zahlreiche Kompositionen, darunter etwa 14 Messen, 16 Motetten und 17 Chansons, wobei die Urheberschaft einiger Stücke umstritten bleibt. Sein Bruder Robert war ebenfalls Komponist, erreichte jedoch nicht den Ruhm und die Produktivität seines Bruders. Antoine de Févin verstarb vermutlich Ende 1511 oder Anfang 1512 in Blois.
Als Zeitgenosse von Josquin des Prez teilte Févin viele stilistische Merkmale mit diesem berühmteren Kollegen. Seine innovative Verwendung des freien Kontrapunkts und der Kontrast zwischen Vokalduetten und vollem Chor zeigen jedoch seine eigene musikalische Handschrift. Der Schweizer Musiktheoretiker Heinrich Glarean erwähnte Févin als Anhänger Josquins und bemerkte seinen frühen Tod.
Févins Musik nimmt eine Zwischenstellung zwischen traditionellen und neueren Kompositionsstilen ein. Seine Werke zeichnen sich durch Expressivität und eine tiefe Verbindung zum liturgischen Text aus. Die strukturelle Gestaltung und ausdrucksstarke Interpretation in seinen Messen demonstrieren sein außergewöhnliches kompositorisches Können.
Die Motette "Sancta Trinitas" gilt als Févins bekanntestes Werk und wird für ihren anmutigen Stil geschätzt. Bei "Ascendens Christus in altum" gab es Zweifel bezüglich seiner Urheberschaft, die jedoch durch neuere Forschungen ausgeräumt wurden. Diese moderne Komposition drückt die Freude über Christi Himmelfahrt aus.
In seiner "Missa Salve sancta parens", die auf einem Introitus für Marienmessen basiert, wendet Févin die Paraphrasen-Technik an. Seine originelle Herangehensweise an die Textinterpretation war für die musikalische Praxis seiner Zeit von großer Bedeutung.