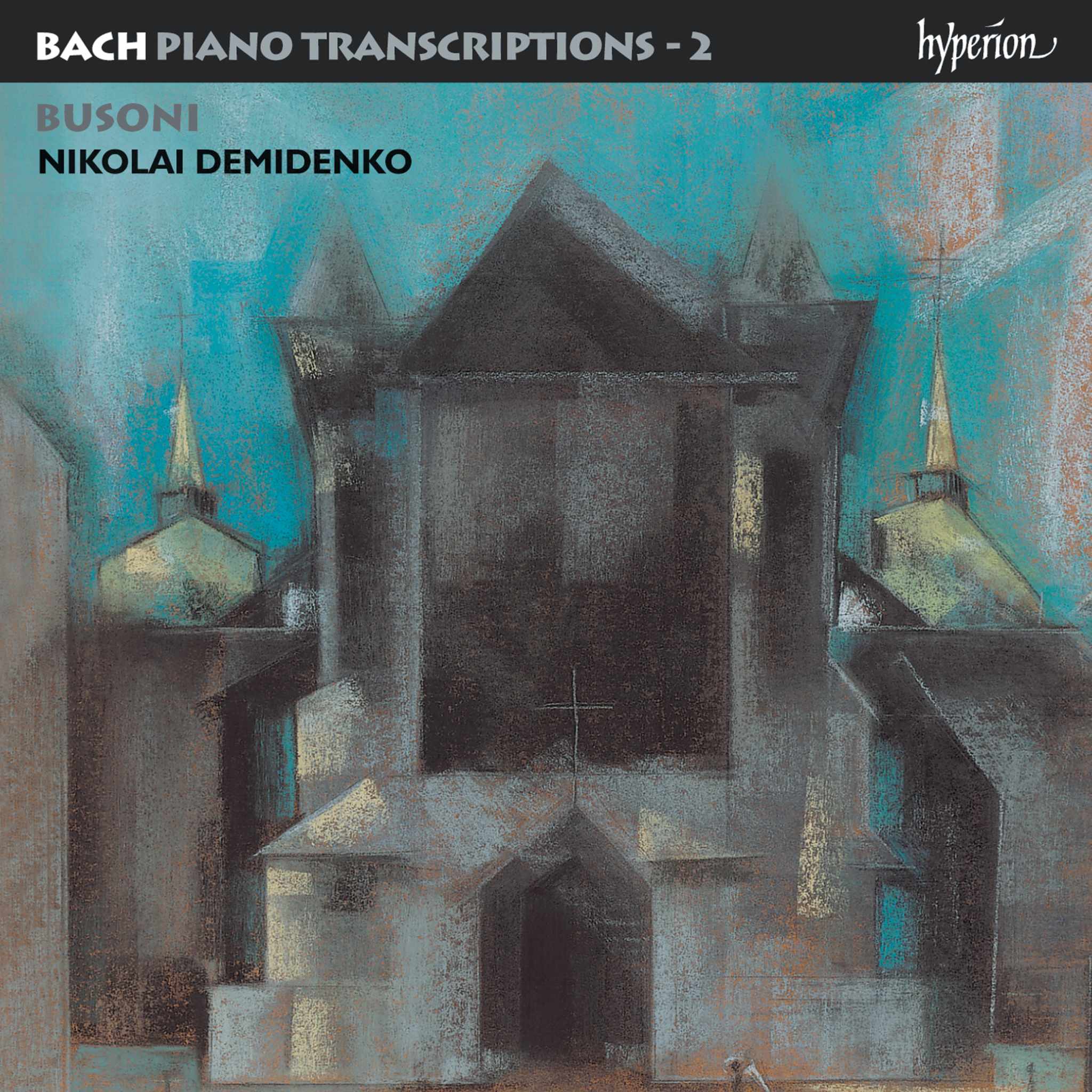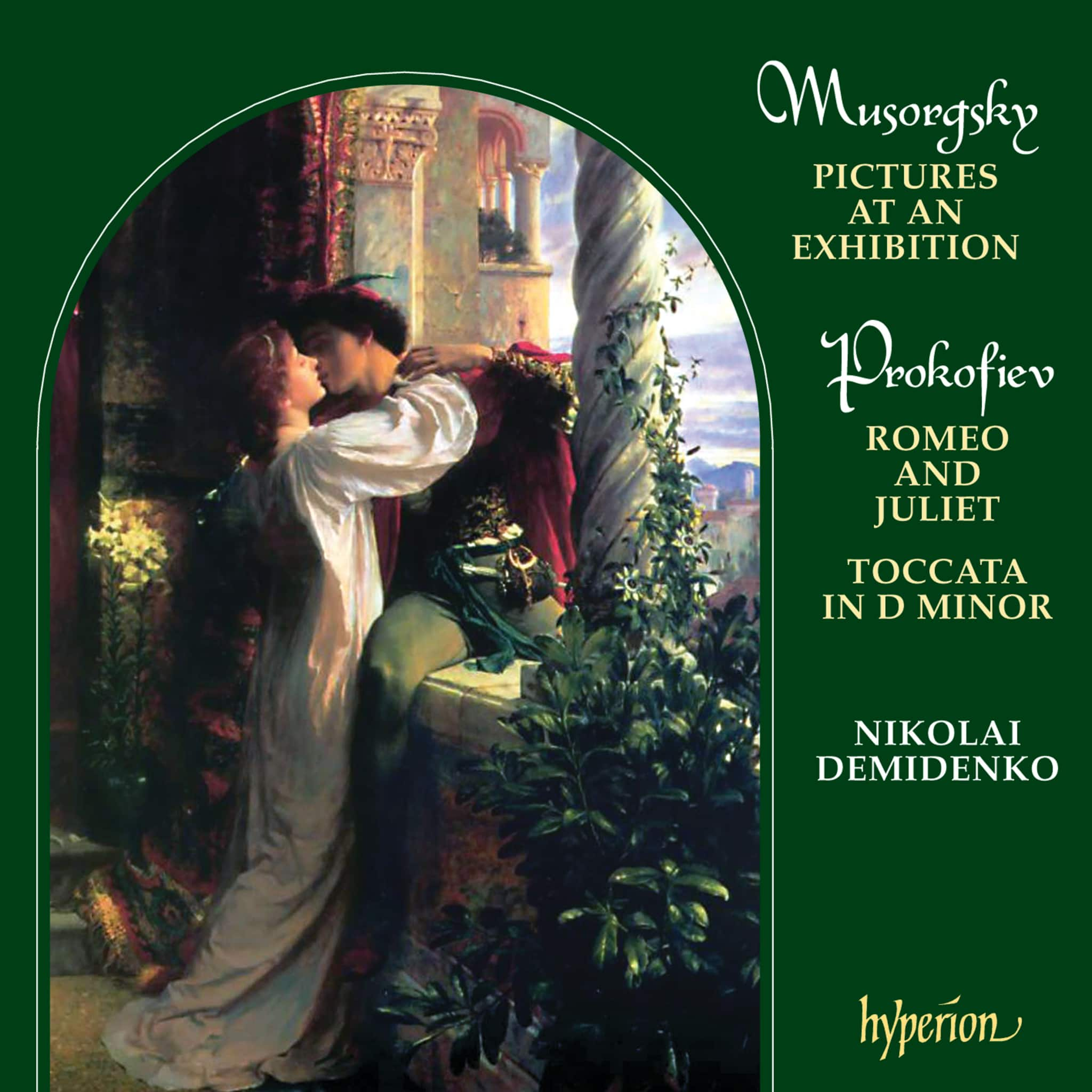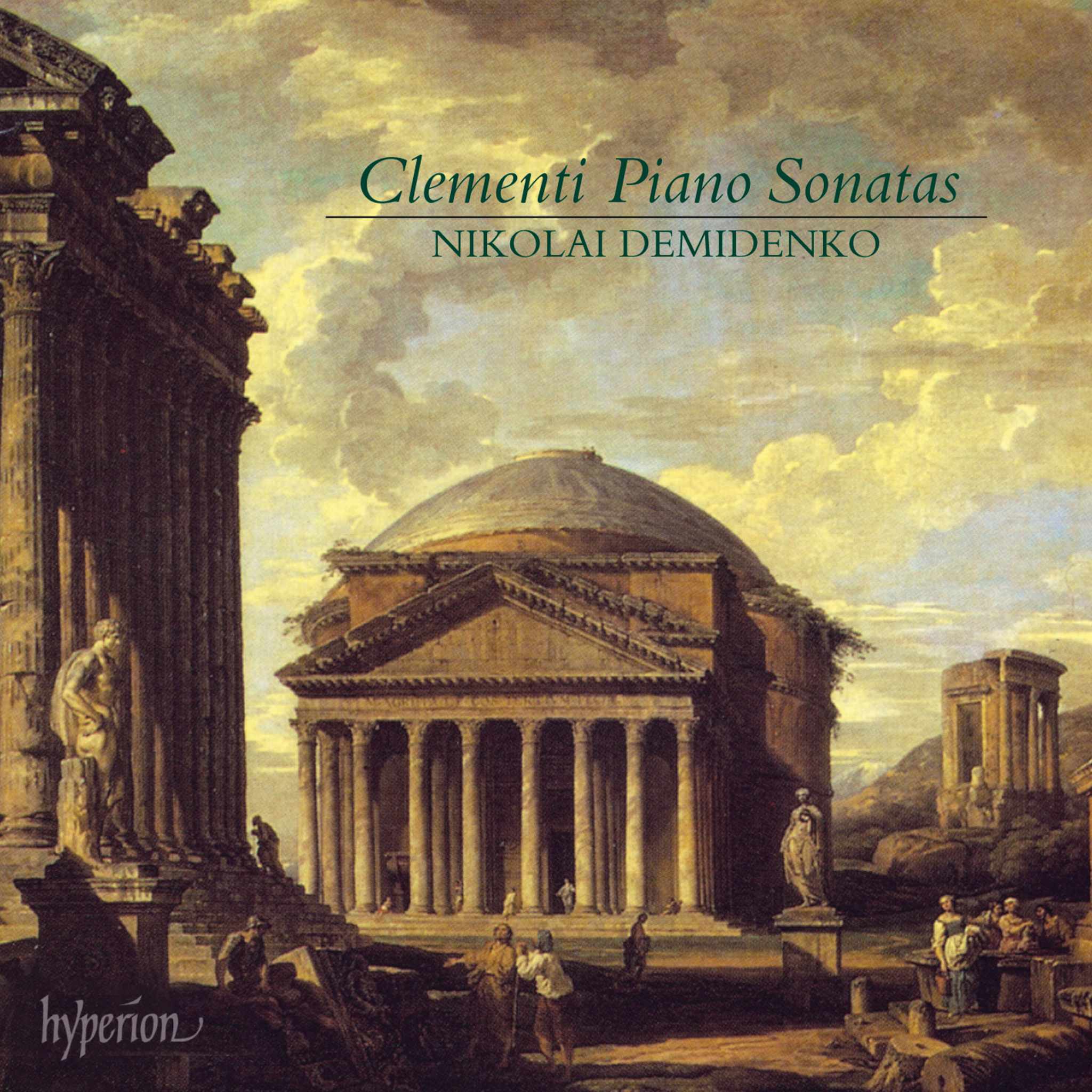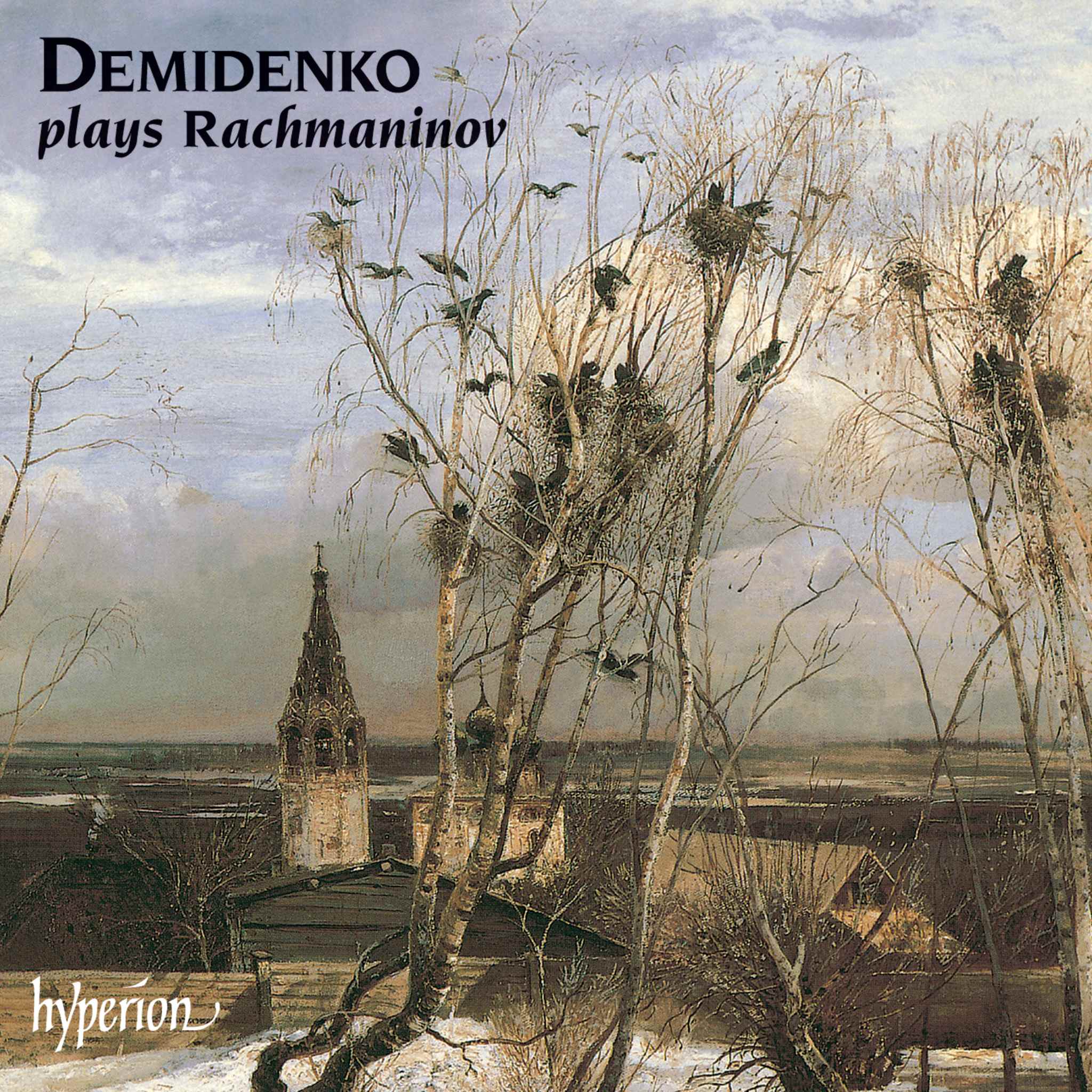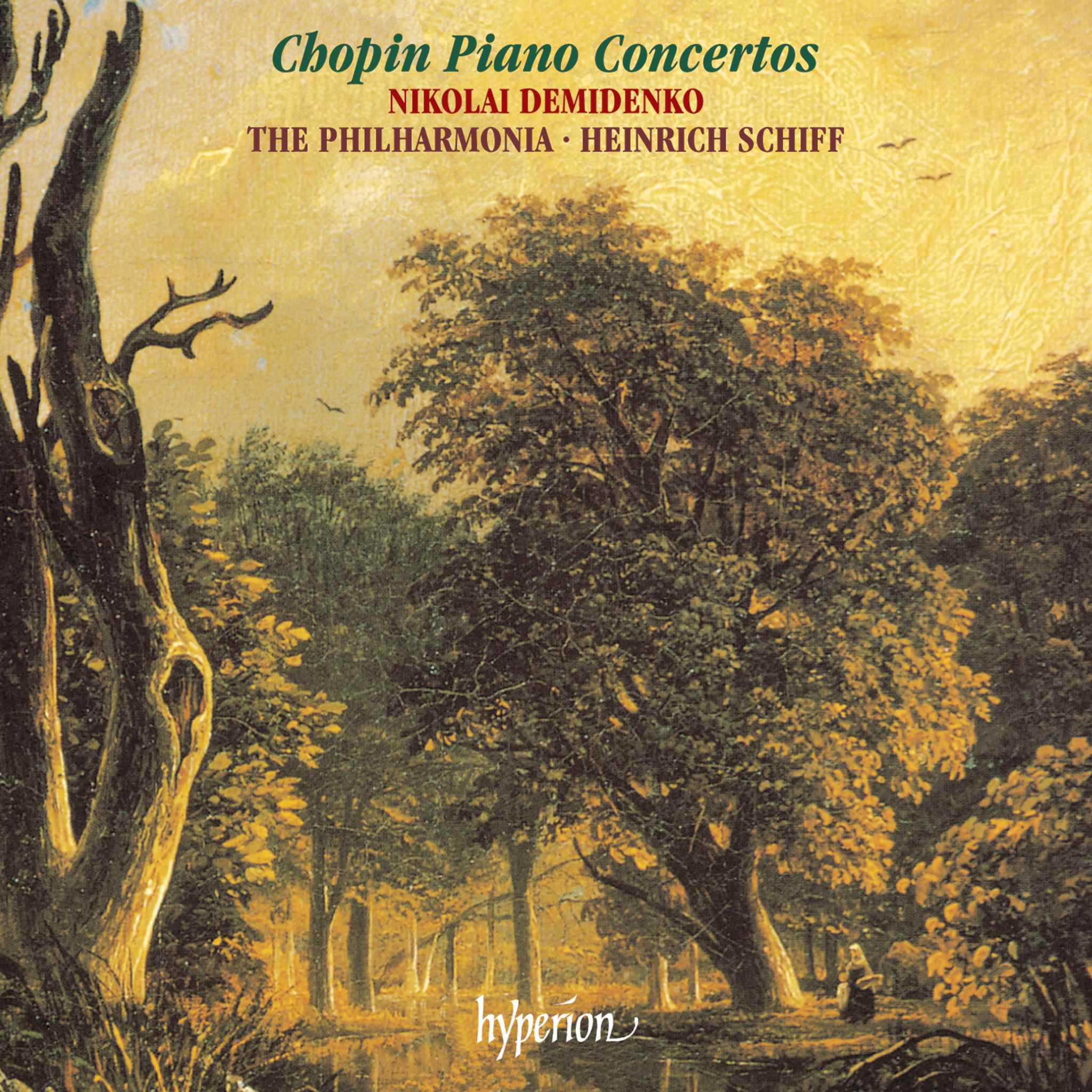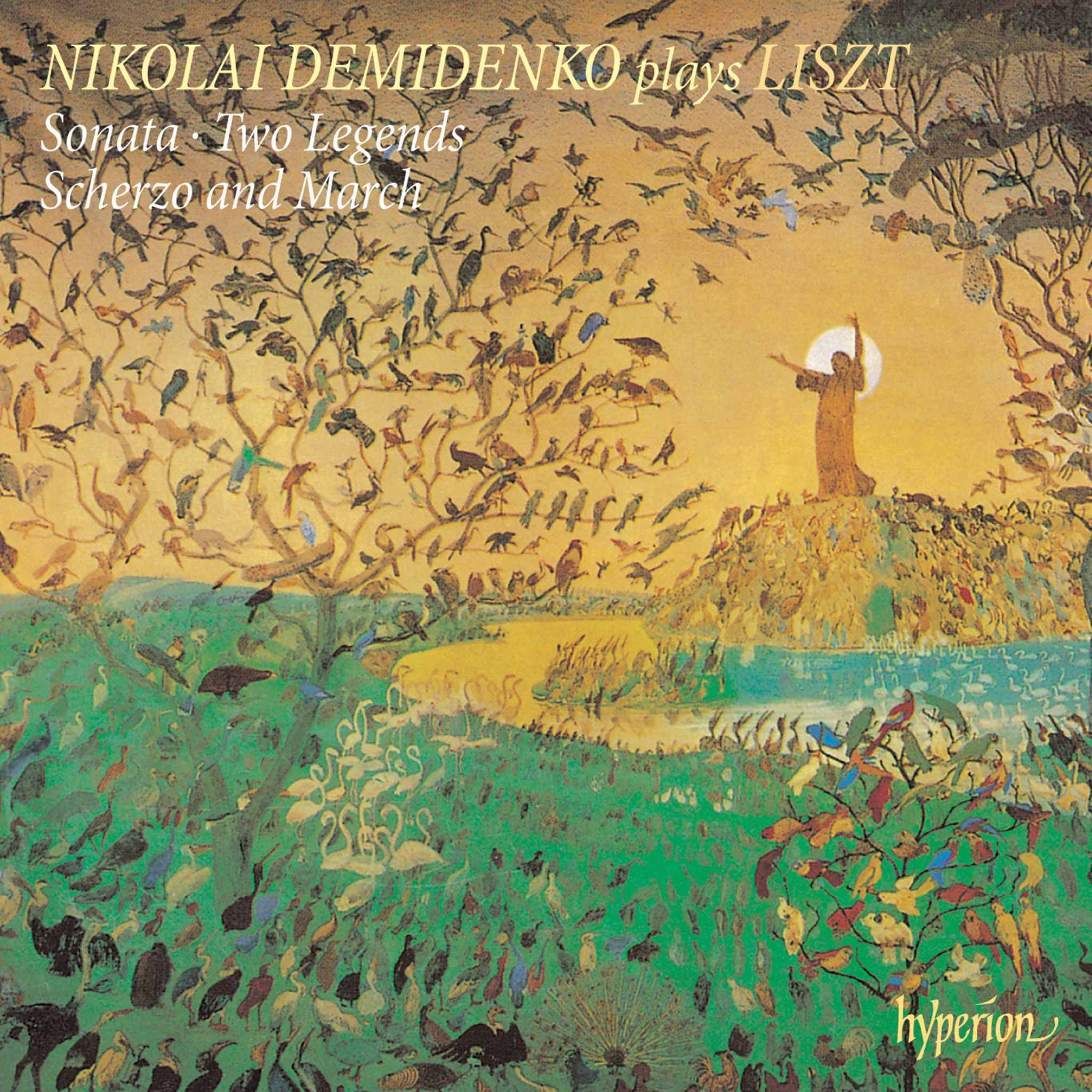Auf diesen beiden CDs finden sich Darbietungen von Nikolai Demidenko, aufgenommen während der Konzertreihe 'Piano Masterworks' in der Londoner Wigmore Hall zwischen Januar und Juni 1993. Die von Ates Orga konzipierte und unter der Schirmherrschaft von Lord Birkett stehende Reihe wurde von Lloyds Private Banking gefördert und umfasste 250 Jahre Klaviermusik - von Scarlatti bis Gubaidulina.
Das Konzept dieser Aufführungen orientierte sich an der romantischen Praxis des 19. Jahrhunderts. In Paris veranstaltete Charles-Valentin Alkan zwischen 1873 und 1877 regelmäßig 'Petits Concerts de Musique Classique' - jeweils sechs Konzerte, die das Repertoire von Couperin, Bach, Händel und Scarlatti bis zu Weber, Chopin, Schumann und Mendelssohn umfassten. Später schuf der Russe Anton Rubinstein einen Zyklus von sieben Historischen Recitals, mit denen er Mitte der 1880er Jahre von Europa Abschied nahm. Diese einzelnen Konzerte dauerten jeweils über drei Stunden und umfassten ein Repertoire von Byrd und John Bull bis hin zu Balakirev und Tschaikowsky. Auch Ferruccio Busoni war wie Franz Liszt historisch bewusst; seine Programmgestaltung reichte von Bach bis Liapunov.