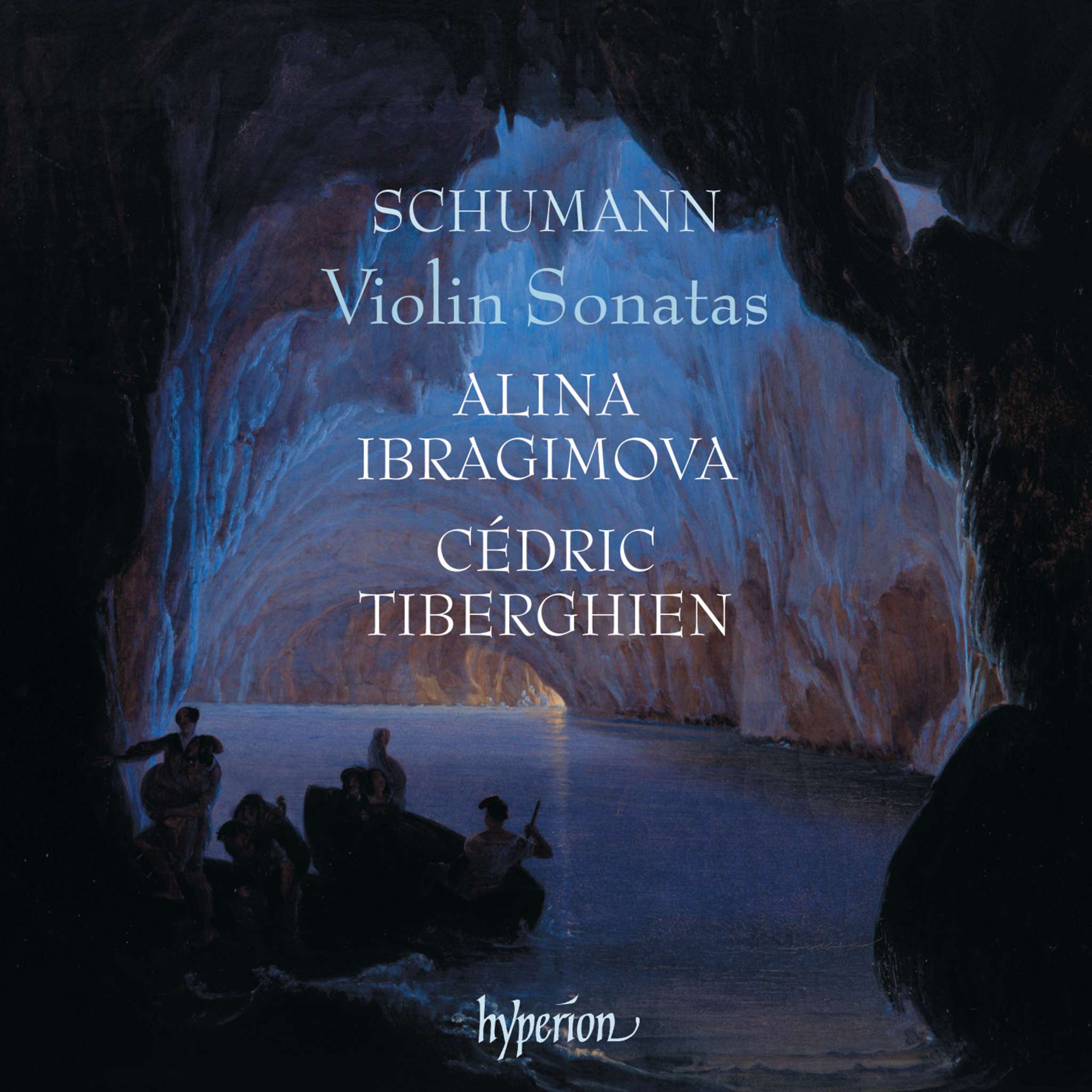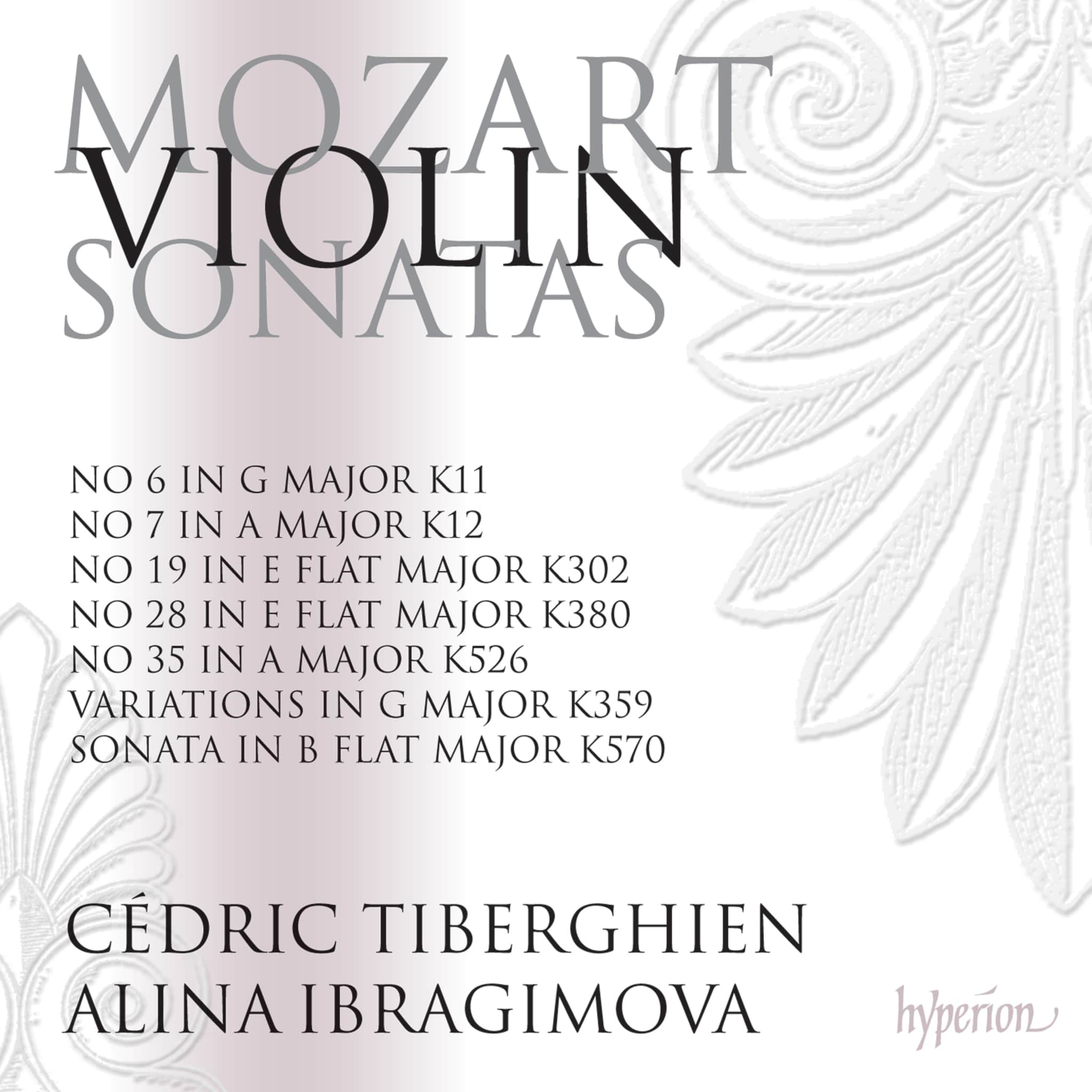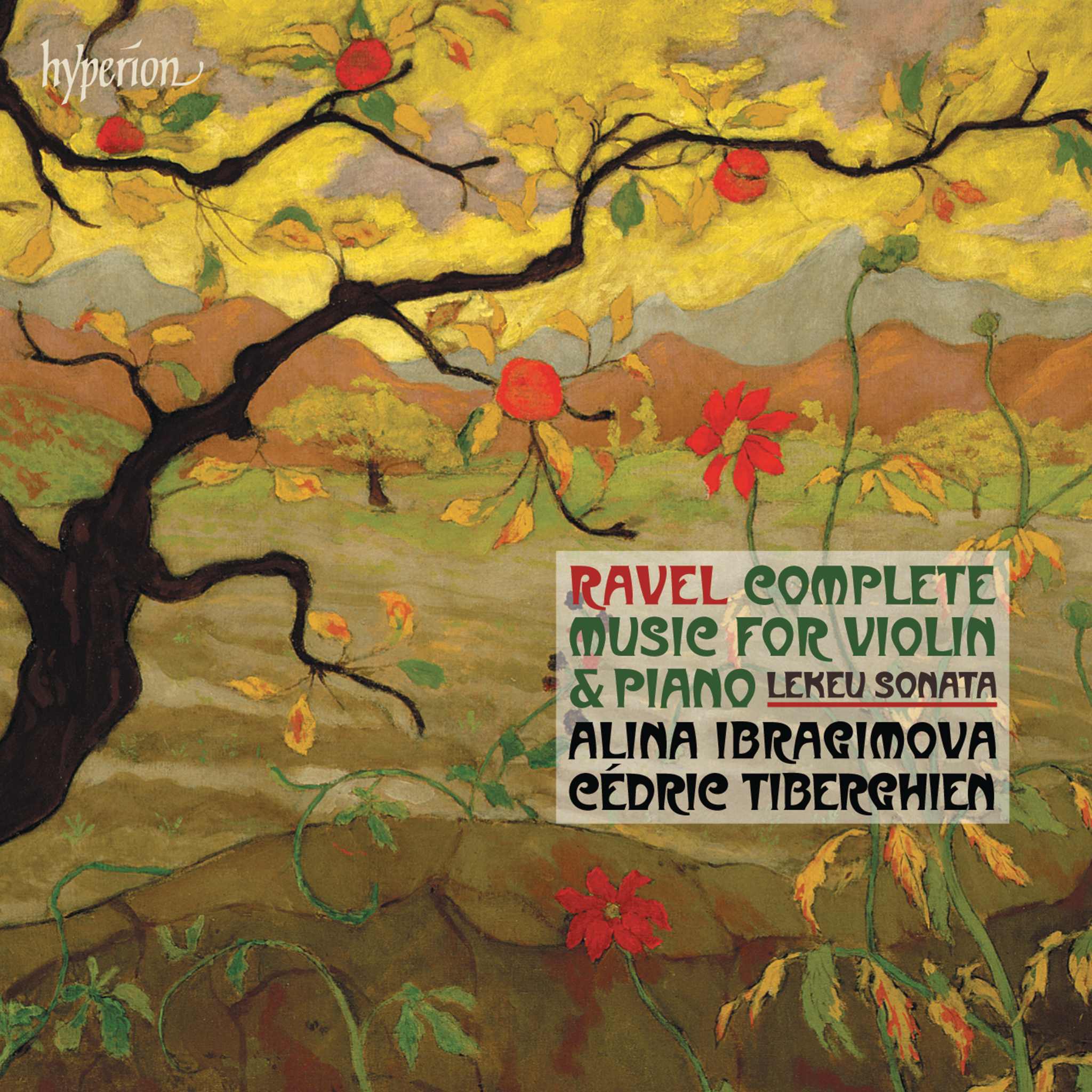Ein hochgewachsener, schlanker Mann, dessen Aussehen ihn älter erscheinen ließ als seine 21 Jahre, betrat den Raum in schwarzer Trauerkleidung, mit Melone und Handschuhen. Sein Auftritt erinnerte eher an einen Diplomaten als an einen Musiker. Dennoch spiegelten seine graublauen, ausdrucksstarken Augen neben tiefer Traurigkeit auch Intelligenz und außergewöhnliche Sensibilität wider. Mit einem leichten Hinken näherte er sich und begrüßte die Anwesenden mit höfischer Zurückhaltung und einem dezenten Lächeln.
Der berühmte Pianist Arthur Rubinstein schilderte in seinen Memoiren „Die frühen Jahre“ seine erste Begegnung mit Karol Szymanowski. Dieses Treffen kam auf Vermittlung des Geigers Bronislaw Gromadzki zustande, der Rubinstein Partituren von Szymanowskis frühen Kompositionen zeigte. Rubinstein war sofort von der Meisterschaft dieser Werke beeindruckt; die Nähe zu Chopin und Skrjabin fiel ihm auf, doch erkannte er bereits die markante Eigenständigkeit des Komponisten in Melodieführung, kühner Harmonik und ungewöhnlichen Modulationen.
Der Aufenthalt in Zakopane begründete die Freundschaft der beiden Künstler, die ein tragisches Ende fand, als Szymanowski nach langem Leiden an Tuberkulose sowie daraus resultierendem Lungen- und Kehlkopfkrebs starb. Die Ursache für sein Hinken lag in einem Unfall in der Kindheit, während er um seinen verstorbenen Vater Stanislaw Korwin-Szymanowski trauerte.
Karol Maciej Szymanowski entstammte einer künstlerisch geprägten Familie, die in der heutigen Ukraine lebte, damals Teil des Russischen Reiches. In seinen Werken vor dem Ersten Weltkrieg zeigten sich Einflüsse von Chopin, Skrjabin, Wagner und Reger. Nach Jahren intensiven Studiums, zahlreicher Reisen und künstlerischer Experimente entwickelte er eine unverwechselbare, exotisch gefärbte Tonsprache.
Während der Kriegszeit vertiefte Szymanowski sein Wissen durch umfangreiche Lektüre und Reisen. Das Interesse an deutscher Musik nahm ab, während ihn die persische Sufi-Tradition und der französische Impressionismus zunehmend inspirierten. Die Revolution von 1917 und andere Umbrüche beeinflussten sein Leben maßgeblich. Nach Jahren voller Kämpfe und Entbehrungen endete sein Leben in Einsamkeit und Krankheit.
Obwohl Szymanowski zu Lebzeiten häufig missverstanden wurde, beeindruckte und inspirierte die Vielfalt seiner Werke viele. Erst jetzt beginnt sein kompositorisches Erbe die Anerkennung zu finden, die ihm gebührt.